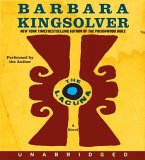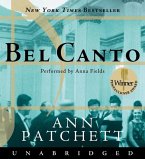Auf der Jagd nach der Frau der Frauen und dem Vers der Verse: Mit "Der Anthologist" hat Nicholson Baker einen Roman über einen Mann auf der Suche nach Unsterblichkeit geschrieben.
Von Jochen Schimmang
Eigentlich geht es um die Frage, ob Rosslyn zurückkommt. Paul Chowder, der gleich zu Anfang von sich mitteilt, sein Leben sei eine Lüge, seine Laufbahn ein Witz, "ich bin der klassische Versager", Paul Chowder also soll eine Einleitung zu einer von ihm zusammengestellten Lyrik-Anthologie schreiben und bringt es nicht auf die Reihe, und deshalb verlässt ihn Rosslyn schließlich nach acht Jahren. Wir haben es also mit dem klassischen Motiv des Autors mit Schreibhemmung zu tun, und das kann bekanntlich zu den langweiligsten Romanen führen, die man sich nur vorstellen kann.
Dieser Kelch geht jedoch im vorliegenden Fall am Leser vorüber. Zwar wendet Baker denselben, in der Natur der Sache liegenden Trick an, dessen sich auch alle anderen Autoren bei dieser Grundkonstellation bedienen: Das Buch, das wegen der Schreibhemmung des Autors nicht zustande kommt, ist eben das Buch, das man am Ende in den Händen hält. Die Einleitung, die Paul Chowder vor sich her schiebt, besteht am Ende genau aus den 255 Seiten, die der deutsche Leser unter dem Titel "Der Anthologist" kaufen kann.
Und da wird es interessant. Chowder hat in der Tat ein Kompendium darüber geschrieben, wie man mit - angelsächsischer - Lyrik umgehen sollte. Schließlich ist er selbst Lyriker, der sich vermutlich schlechter macht, als er ist. Er hat einige Bände veröffentlicht und war in den einschlägigen Anthologien und Zeitschriften (der "New Yorker"!) vertreten. Natürlich, an einer Stelle sagt er das selbst, wird man seine Gedichte vergessen, "bis auf ein oder zwei". Die Hoffnung hat er aber auch noch aufgegeben: "Ich würde alles tun. ich würde buchstäblich alles tun, um ein richtig gutes Gedicht zu schreiben." Damit wäre er nach eigenen Kriterien schon unter den Unsterblichen, denn 82 Seiten später heißt es: "Was es bedeutet, ein großer Dichter sein? Dass man ein oder zwei große Gedichte geschrieben hat."
Jetzt aber liefert er eine Einführung in die Lyrik und eine persönliche Poetik in eins, und je länger das dauert, desto kurzweiliger wird es. Denn es braucht eine Weile, bis Paul Chowder in Fahrt kommt. Schließlich hat er ja eine Schreibhemmung, und wenn es auf Seite 18 heißt: "Was soll's. Jetzt sind wir schon mittendrin, legen wir los", dann ist er noch lange nicht mittendrin, weil ihm ständig etwas in die Quere kommt. Vor allem natürlich der Gedanke an Rosslyn , von der es zwar schon auf Seite 13 heißt: "Ich sollte am besten gar nicht mehr von ihr sprechen", die aber fast über jede Seite des Buches huscht. Dann diese Geschichte mit der Nachbarin, die einen neuen Freund hat und deren Rasenmäher Chowder repariert, denn wenn man Rasenmäher repariert, braucht man keine Einleitungen zu schreiben. Man kann auch dem Nachbarn die Wohnung streichen, und dass der Hund seine Zuwendung braucht, versteht sich von selbst. Andererseits muss jetzt endlich mal das Konto aufgefüllt werden.
Immerhin hat Bakers Protagonist dem Leser zu diesem frühen Zeitpunkt schon die Angst vor Gedichten genommen: "Versmaße kennen Sie ja schon. Wenn Sie sie hören, wissen Sie Bescheid. Sie wissen nur nicht, dass Sie es wissen. Sie als Gelegenheitsleser von Lyrik, als Gelegenheitshörer von Popsongs, verstehen vom Versmaß mehr als die Metriker, die es jahrhundertelang missdeutet haben. Und selbst die haben mehr davon verstanden, als ihnen klar war."
Damit ist eins der beiden Hauptmotive angeführt, um die diese plaudernde Einleitung kreist, das Versmaß. Das andere Motiv ist der Reim. Als Schüler hat er gelernt: "Es muss sich nicht reimen", und diese Botschaft macht ihn offenbar immer noch wütend, denn er weiß: "Die Zunge ist reimverliebt. Sie will reimen, weil das ihr Klassifizierungsprinzip ist. Sie hat eine detaillierte Checkliste der Muskelbewegungen für jeden Konsonanten und jeden Vokal." Und: "Gereimte Gedichte machen sich lediglich diese Klangkurven zunutze und rufen uns somit in Erinnerung, dass wir sie schon immer im Kopf hatten."
Nicht etwa dass Chowder gereimte Gedichte schriebe. Vielleicht traut er sich nicht, der Sündenfall des "Modernismus" hindert ihn. Wer ihn begangen hat, ist für Chowder, und ich denke in diesem Fall auch für Nicholson Baker, ganz klar. Der Erzfeind, der "Grund allen Übels", wie es an einer Stelle heißt, ist Ezra Pound, der andere Erzfeind Marinetti: "Pound, von Haus aus ein aufbrausender Eiferer, ein humorloser Witzbold, ein talentloser Pasticheur, ein Taschenspieler, wurde mittlerweile vom amerikanischen Staat unterhalten." Marinetti ist "der manische Pippo, der das zwanzigste Jahrhundert nach seinem Bild marinierte." Auch die Poeten des Black Mountain College mag Chowder nicht so sehr. Charles Olson etwa ist "durchgeknallt", und der wunderbare Robert Creeley wird gar nicht erst erwähnt.
Das mit dem "wunderbaren Robert Creeley" war jetzt natürlich ein Geschmacksurteil meinerseits, und auch Paul Chowder enthält sich nicht der Geschmacksurteile. Er singt das Loblied mancher Lyriker, von denen wir in Deutschland vermutlich noch nie etwas gehört haben. Er zitiert sie, aber er singt sie auch im Wortsinn: so manche Gedichtzeile in diesem Band ist mit Noten versehen. Schließlich hat Nicholson Baker die Eastman Music School in seinem Geburtsort Rochester besucht. Und er macht uns klar, dass wir täglich von viel mehr Lyrik umzingelt sind, als uns bewusst wird. Je länger das dauert, desto mehr Fahrt nimmt es auf und nimmt uns mit, auch wenn da immer noch Rosslyn ist, von der wir nicht erfahren werden, ob sie zurückkommt, denn mit der fertig geschriebenen Einleitung ist notwendigerweise auch der Roman zu Ende.
Nicholson Baker ist mit seinen Gegenständen und seinen Figuren immer sehr achtsam, geradezu zärtlich umgegangen. Das ist hier nicht anders. Am Ende fragt sich der "Gelegenheitsleser von Lyrik und Gelegenheitshörer von Popsongs" tatsächlich, warum er nicht viel mehr Gedichte liest. Dabei ist es so einfach, denn das Besondere an Gedichtbänden ist ja, "dass man sie an einer beliebigen Stelle aufschlagen kann und einen Anfang hat... Das erlaubt mir die Poesie. Viele, viele Anfänge."
Bakers Roman, und das spricht am stärksten für ihn, ist vielleicht genau die ultimative Vorlesung über die Notwendigkeit von Gedichten, die Studenten heute an den Universitäten nicht zu hören bekommen (und früher vielleicht auch nicht zu hören bekamen). Sie brauchen nicht mitzuschreiben. Sie sollten nach der Vorlesung einfach nur mal den nächsten Gedichtband nehmen und ihn aufschlagen und sehen, ob und wie da etwas anfängt.
Nicholson Baker: "Der Anthologist". Roman. Aus dem Englischen von Matthias Göritz und Uda Strätling. C. H. Beck Verlag, München 2010. 255 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main