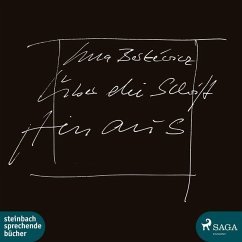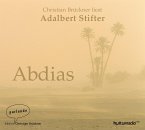In einer überwältigenden poetischen Phantasie überschreitet in der dreizehnten Stunde einer Faschingsdienstagnacht eine Dichterpartisanin die Schwelle des Erzählens und ein Mathematikrebell die Zählbarkeit der Zahl. Das sprengt eine
Potentaten-, Künstler- und Bürgergesellschaft aus ihrem Rahmen, so dass sie den beiden in ihre Vorstellungsfreiheit folgen kann. Dadurch entwickelt sich eine so provokante wie kompromisslose Prosaschrift, die zeigt, was möglich ist, wenn wir unsere Wahrnehmung nicht auf unsere Sphäre der drei Dimensionen beschränken.
Potentaten-, Künstler- und Bürgergesellschaft aus ihrem Rahmen, so dass sie den beiden in ihre Vorstellungsfreiheit folgen kann. Dadurch entwickelt sich eine so provokante wie kompromisslose Prosaschrift, die zeigt, was möglich ist, wenn wir unsere Wahrnehmung nicht auf unsere Sphäre der drei Dimensionen beschränken.
| CD 1 | |||
| 1 | Über die Schrift hinaus - Teil 1 | ||
| CD 2 | |||
| 1 | Über die Schrift hinaus - Teil 2 | ||
| CD 3 | |||
| 1 | Über die Schrift hinaus - Teil 3 | ||
| CD 4 | |||
| 1 | Über die Schrift hinaus - Teil 4 | ||

Ulla Berkéwicz moduliert in "Über die Schrift hinaus" die Grenzen der Wahrnehmung
Ein kleines Wortspiel, das die Richtung vorgibt: "Sagten und sangen sie so . . .", schreibt Ulla Berkéwicz in ihrem neuen Buch "Über die Schrift hinaus" und erinnert damit natürlich an Heiner Müllers unvergessenes Diktum: "Was man noch nicht sagen kann, kann man vielleicht schon singen." Irgendwo zwischen diesen Polen oszilliert die Wahrheit, nie leicht zu fassen, nicht in Worten oder in Klängen, aber im Doppelpass möglicherweise zumindest zu erahnen. Einen Gattungsbegriff hat dieser Text von Ulla Berkéwicz nicht, man könnte ihn am ehesten als eine "Grenzüberschreitung" bezeichnen, denn Fiktionen oder Tatsachen sind ihm lediglich das Material, aus dem die Autorin ihre Phantasien von einem Denkraum ohne einengende Kategorien und einer Wahrnehmung ohne narrative Demarkationslinien oder technokratische Zensur errichtet.
In zwei Teilen wandert sie mit großen, autarken, lässig unregelmäßig gesetzten Schritten durch zahlreiche bekannte wie exquisit abgelegene Wissensfelder. Im ersten Teil sind es etwa "Kirche, König, Kapital", die in poetisch-essayistischer Form gestreift und betrachtet werden, wobei es bei Berkéwicz nur einen Wimpernschlag von der Französischen Revolution bis zur Netzgesellschaft braucht und von der Kabbala bis zur Kybernetik, von den Frühromantikern bis zu "LSD-Aktivisten" oder vom Rabbi Löw bis zu Norbert Wiener. Von hebräischer Vernunft und griechischem Logos wird zum Darwinismus oder sogar zu Hitlers Lebensraumpolitik übergeleitet, nicht vergessend "kalifornische Eugeniker", die sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verdrückten: "Als sie wieder auftauchten, benannte man die Eugenik in Humangenetik um."
Im Grunde sind es die ewigen Fragen, wie sich nämlich technische Entwicklungen und zivilisatorische Standards versöhnen können, die hier mit mäandernder Akribie und künstlerischer Emphase aufgeworfen werden. Im Wettkampf zwischen analogem und digitalem Weltverständnis plädiert Ulla Berkéwicz für eine Internationale des Zweifels und der Ungewissheit, für ungläubiges Fragen statt für beharrende Antworten, und vertraut auf den Zusammenschluss intellektueller wie emotionaler Kräfte, basierend auf der Tatsache, dass "die Menge aller Zahlen" mehr ist "als jede beliebige Zahl".
Die dichterische Kombination aus Traum und Realität, aus Mystik und Mathematik ist kühn und keck und natürlich so hochgespannt wie angreifbar. Ulla Berkéwicz geht trotz jedweder inhärenter Gefährdung ungeschützt aufs Ganze, weil ihr das sichere Halbherzige - man könnte es auch Halbgare nennen - einfach nicht genügt. Besonders deutlich wird diese kreativ-elegante Vermessenheit im zweiten Teil, der in Form eines turbulenten diskursiven Einakters in ein typisches Wiener Kaffeehaus führt und ungebundene Geister aller Art versammelt: Friederike Mayröcker und Ann Cotten, Maria Callas und Ingeborg Bachmann, Marylin Monroe und Romy Schneider, den Kellner Franz "mit einer Tellerpalatschinke auf der flachgehaltnen Hand" und den bereits in den vorherigen Abschnitten aufgetretenen geheimnisvollen russischen Mathematiker Grigori Jakowlewitsch Perelman. Da hebt sich dieses aufs schönste unlogische und aufs mutigste universale Traktat dann endgültig vom Boden ab und verwirbelt sich in einen theatralisch absurden Strudel aus Witz, Esprit und tieferer Bedeutung. Es flirrt, es glitzert, es regt an, es ruft nach der Bühne - vor allem im eigenen Kopf.
IRENE BAZINGER
Ulla Berkéwicz: "Über die Schrift hinaus".
Suhrkamp Verlag, Berlin 2018. 116 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

selber bringt
Ulla Berkéwicz denkt
„Über die Schrift hinaus“
Kulturkritik hat Hochkonjunktur. Die weltweite schnelle Durchsetzung der digitalen Revolution hat in Verbindung mit einem ebenso dynamischen wie oft auch zerstörerischen Kapitalismus dazu geführt, dass Skeptiker ganz unterschiedlicher Couleur nach Entschleunigung und neuer Besinnung auf das wahrhaft Wichtige im Leben rufen.
Auch Ulla Berkéwicz setzt in ihrem Essay „Über die Schrift hinaus“ auf uralte religiöse Mythen, um gegen die von ihr beklagte fortschreitende Dehumanisierung des Menschen individueller Freiheit und reflektierter Selbstbestimmung Geltung zu verschaffen. In ihrer teils unterhaltsamen, teils redundanten Assoziationsprosa knüpft sie an die Romantiker um 1800 an, deren frommer Protest gegen Verstandesherrschaft und rein prozedurale Vernunft noch immer starke Wahrheitsmomente berge. Zwar seien die Romantiker mit ihren Utopien einer ganz anderen Gesellschaft damals an der Macht des restaurativen Staates und einer mit ihr verbündeten autoritären Kirche gescheitert. Aber ihre Kritik an allumfassender Entfremdung und Mechanisierung des Lebens sei mehr denn je berechtigt.
Denn unser Leben werde zunehmend vom „Golem unserer Tage“, dem „Komputer“, bestimmt, der die „Erfahrung von Welt“ durch Berechenbarkeit, Manipulation, Simulation und Emulation ersetzt habe. Fortwährend werde die Weisheit alter Wissenschaften vom „universalen Gleichgewicht“ durch „kommerzialisierte Zweigwissenschaften“ wie die „Zombiologie“ und die „Technomagie“ entwertet. Indem wir uns selbst berechenbar machten, schritten wir nur auf dem „Abweg“ voran, „uns selber um uns selbst zu bringen“.
Gottverlassenheit sei die Signatur unserer Gegenwart, in der ein globaler Kapitalismus die neuen „elektronischen Denksysteme“ als „Herrschaftsinstrument seiner Verkommenheit“ nutze. Walter Benjamins „Weltzustand der Verzweiflung“ sei im Valley nun auf die Spitze getrieben worden, nur zwei Jahrzehnte nach Monterey und Woodstock. Den egozentrischen neuen Nerds aus den Cyberwelten wirft Berkéwicz vor, in ihrer „Ichbezogenheit, Selbstüberschätzung, Enthemmung“ und „Exaltation“ nur ein neues Heidentum zu verkünden: „Übermenschenideologie, Auserwähltheitsfieber, esoterisch, rassistisch, amerikanisch konsumtiv“. Vor allem den Technologen der „Künstlichen Intelligenz“ wirft sie Gewissenlosigkeit, Habgier und den „konformen“, kollektiven Wahn vor, „technologischem Firlefanz metaphysische Bedeutung“ anzudichten und „mit neuen ökonometrischen Methoden alten Aberglauben anzudrehn“.
Aber die Eigentümerin des Suhrkamp-Verlags kennt die entscheidende Gegenmacht: die Offenbarung einer Wahrheit, die sich jenseits alles Zählbaren, Messbaren erschließt. Bedeutende Wegbereiter der modernen Kybernetik wie Norbert Wiener und der Informatiker Joseph Weizenbaum hätten sich das Wissen um die elementare Ambivalenz ihrer Denkmaschinen bewahrt. Und der geniale russisch-jüdische Mathematiker Grigori Jakowlewitsch Perelman habe 2002 die „Poincarésche Vermutung“ aus dem Jahr 1890 bewiesen, dass der Kern unseres Universums als dreidimensionale Kugel zu bestimmen sei. Dies biete nun die Chance, ganz neu über „Zeit, Raum, Existenz und andere vereinfachende Kategorien, die unsrer Wahrnehmung zugrunde liegen, nachzudenken und hiermit auch über das Unendliche“. Berkéwicz beschwört so den „Geist, der war, bevor etwas war, wo der Geist mit dem Geiste im Geiste“ war – und so fort.
Über vage Andeutungen, dass alles Offenbare immer „mit einem Fuß oder zweien im Nichtoffenbaren“ gründe und das Göttliche das zentrale „Synonym für Freiheit“ sei, kommt sie trotz vielfältiger Bezüge auf rabbinische Überlieferungen und moderne Glaubensdeuter nicht hinaus. Wie das Jenseits zur bestimmenden Kraft des Diesseits zu werden vermag, bleibt unklar. Empfohlen wird „Versenkung“ und „Hinabsteigen ins eigene Nichts“, wobei der „Vedenwind von Vorstellung und Phantasie“ helfen soll. Dazu führt die Autorin den Leser in ein altes Wiener Caféhaus, wo bei einer Fastnachtsparty Perelman auf so unterschiedliche Personen wie Friederike Mayröcker, den Kellner Franz und die Dichterin Ann Cotten trifft. Auch in großen Porträts abgebildete Gestalten wie die Romanows, Maria Callas, die Romysissy und der Tänzer Nijinski in seinem Faunsgewand von 1912 feiern mit, indem sie den jeweiligen Bilderrahmen an der „Portraitantenwand“ sprengen und sich im heiteren Palaver wechselseitig der Einsicht versichern, dass die Gesetze der Bedingtheit mathematisch, die der Unbedingtheit hingegen poetisch seien. Aber jede Party geht einmal zu Ende, am Aschermittwoch ist auch das Sinnspiel vorbei, demzufolge es mehr Dimensionen gibt, als man gemeinhin zu wissen meint. Aus dem Rahmen zu fallen, mag eine Transzendenzerfahrung sein. Aber die Botschaft, dass das wahre Leben noch immer analog geführt werden muss, bleibt, trotz aller poetischen Glaubensbeschwörung, trivial.
FRIEDRICH WILHELM GRAF
Ulla Berkéwicz: Über die Schrift hinaus. Suhrkamp Verlag, Berlin 2018. 116 Seiten, 22 Euro.
Beschworen wird der
„Geist, der war,
bevor etwas war“
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Friedrich Wilhelm Graf lernt Ulla Berkewicz als Romantikerin kennen in ihrer Kulturkritik "Über die Schrift hinaus". Der "Komputer" (sic), der "Golem unserer Tage", manipuliere unser Leben zunehmend, die enthemmten, ichbezogenen "Nerds" aus dem Silicon Valley verkünden indes eine neue "Übermenschenideologie", "rassistisch" und "amerikanisch konsumtiv", liest Graf bei Berkewicz. Natürlich weiß die Verlegerin, wo Abhilfe zu finden ist, so der Kritiker: Mit Verweisen auf den Kybernetiker Norbert Wiener, den Informatiker Joseph Weizenbaum und den russisch-jüdischen Mathematiker Grigori Jakowlewitsch Perelman empfehle die Autorin "Versenkung", so der Rezensent weiter, der schließlich etwas ratlos mit Berkewicz, den Romanows, Maria Callas und der "Romysissy" im Wiener Cafehaus landet.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Dieses Buch ist ... eine fantastische Übertreibung dessen, was Prosa bisher wagte, eine Verschiebung der Grenzen des Sagbaren.« Daniela Dahn der Freitag 20181004