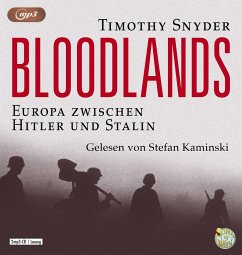-8%20)

Unser Jahrhundert
Ein Gespräch (5 CDs). Gekürzte Lesung. Bonustrack mit Auszug aus dem Originalgespräch. 307 Min.. CD Standard Audio Format.Lesung
Gesprochen: Zischler, Hanns; Hallwachs, Hans Peter
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Statt: 24,99 €**
22,99 €
inkl. MwSt.
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
11 °P sammeln!
"Fangen Sie an, Fritz" - mit diesem Satz beginnt ein Gespräch unter Freunden. Helmut Schmidt und Fritz Stern kennen sich seit vielen Jahren und haben sich im Sommer 2009 zusammengesetzt, um über Themen miteinander zu reden, die ihnen am Herzen liegen: Erfahrungen und Lehren aus der Geschichte, das gemeinsam erlebte Jahrhundert, Menschen, die ihnen begegnet sind.Das Ergebnis ist so anregend wie kurzweilig. Der Politiker und der Historiker spielen sich die Bälle zu, mal im Konsens, mal im Widerspruch, stets auf eine pointierte Darlegung ihrer eigenen Positionen bedacht. Das Spektrum der behan...
"Fangen Sie an, Fritz" - mit diesem Satz beginnt ein Gespräch unter Freunden. Helmut Schmidt und Fritz Stern kennen sich seit vielen Jahren und haben sich im Sommer 2009 zusammengesetzt, um über Themen miteinander zu reden, die ihnen am Herzen liegen: Erfahrungen und Lehren aus der Geschichte, das gemeinsam erlebte Jahrhundert, Menschen, die ihnen begegnet sind.Das Ergebnis ist so anregend wie kurzweilig. Der Politiker und der Historiker spielen sich die Bälle zu, mal im Konsens, mal im Widerspruch, stets auf eine pointierte Darlegung ihrer eigenen Positionen bedacht. Das Spektrum der behandelten Fragen reicht von Bismarck bis Israel, vom Zweiten Weltkrieg bis zum Aufstieg Chinas, vom Rückblick auf die Ära Bush bis zu den überhöhten Boni für Banker - und auch die Anekdoten kommen nicht zu kurz.In Szene gesetzt von Hanns Zischler und Hans Peter Hallwachs.