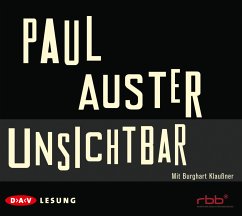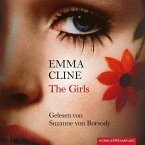New York 1967: Adam Walker ist ein introvertierter Student mit literarischen Ambitionen. Auf einer Party lernt er Rudolf Born und dessen verführerische Freundin kennen und stürzt sich in eine unheilvolle Dreiecksbeziehung. Adams Leben nimmt eine dramatische Wendung, als die mühsam verborgene Gewalttätigkeit Borns hervorbricht und einen Menschen das Leben kostet. 40 Jahre später schreibt Adam die dramatischen Ereignisse jenes Sommers auf und hinterlässt eine Geschichte mit vielen Unbekannten. Ein Roman über menschliche Fehlbarkeit und das Zerbrechen moralischer Gewissheiten - kunstvoll gelesen von Burghart Klaußner.

Paul Auster legt in seinem Roman "Unsichtbar" viele Spuren aus, denen zu folgen sich lohnt. Dass man dabei an irgendein Ziel käme, ist vom Autor aber nicht beabsichtigt. Denn seine Wahrheit war schon immer die Lüge.
Von Tobias Döring
Eigentlich ist das Erzählen ein ziemlich rätselhafter Vorgang: Jemand übermittelt uns etwas in Worten, von dessen Existenz wir meistens nur durch diese Worte überhaupt erfahren und das für uns in solcher Übermittlung gleichwohl Dringlichkeit und wahrhafte Präsenz gewinnen kann. Je stärker dies der Fall ist, also je mehr uns das Erzählte anspricht, bewegt, berührt, ergreift und fesselt, desto williger vergessen wir den Vorgang des Erzählens selbst und wollen uns ganz auf das einlassen, wovon die Rede ist - die eigentliche Gegenwart verblasst. Die Person eines Erzählers wird dadurch allerdings nur umso machtvoller. Richtig spannend gerät die Geschichte meistens dann, wenn wir uns darin verlieren können und die Rolle des Erzählers, der doch alles nur mit Worten ausmalt oder schlicht erfindet, aus dem Blick verlieren. Dann hat er uns ganz in der Hand. Wie ein Puppenspieler führt er nicht nur die Figuren an den Fäden, sondern auch sein Publikum. Seine größte Macht liegt darin, selber unsichtbar zu sein.
Der neue Roman von Paul Auster mit dem Titel "Unsichtbar" gibt reichlich Gelegenheit, dieses Rätsel zu erkunden. Wie in einem Selbstversuch unterzieht er altbewährte Kniffe der Erzählkunst einem neuerlichen Wirkungstest und nötigt uns ganz nebenbei, unsere eigene Verführbarkeit durch Wortbeschwörer, Weltversprecher oder andere Sprachartisten auszutesten.
Mit souveräner Könnerschaft werden wir hier immer wieder in den Sog einer Geschichte gezogen, die so ziemlich alles bietet, was das Leserherz begehrt: einen Campusroman mit literarisch ambitioniertem Helden; einen Spionagethriller aus den Zeiten, da der Kalte Krieg sich zu den Kolonialkriegen in Algerien und Vietnam ausweitet; eine Initiationsgeschichte, die den Helden durch Mord und andere Verbrechen in die Verderbtheit der modernen Welt einführt. Dazu diverse sexuelle Abenteuer sowie vor allem die so unerhörte wie gefühlsgewaltige Geschichte der verbotenen Geschwisterliebe, auf die sich der Protagonist für die Dauer eines kurzen, heißen Sommers einlässt. Doch immer, wenn die Sache hochkocht und wir uns vom Erzählten bedenkenlos mitreißen lassen wollen, bricht der Roman mit der Illusion: Der Vorgang des Erzählens selbst rückt in den Vordergrund und konfrontiert uns mit der Frage, ob Wortgespinsten überhaupt zu trauen ist. Die Macht dieses Erzählers liegt also eher darin, je nach Bedarf sichtbar zu sein.
Dazu genügt ein Wechsel der grammatischen Person, in der das Geschehen übermittelt wird. Denn keineswegs, so stellt sich bald heraus, ist Selbsterlebtes stets am besten in der ersten Person vorzutragen: "Indem ich von mir selbst in der ersten Person schrieb, hatte ich mich lahmgelegt, mich unsichtbar gemacht, mir die Möglichkeit genommen, das zu finden, wonach ich suchte. Ich musste mich von mir trennen, einen Schritt zurücktreten und ein wenig Raum zwischen mich und meinen Gegenstand (der ich selbst war) bringen."
Diesen Rat erteilt hier ein Erfolgsschriftsteller seinem alten Freund, zu dessen autobiographischem Nachlassverwalter er unversehens wird. Im Weiteren wird dieser "Raum", von dem er spricht, gleich mehrfach neu vermessen, denn mit jedem Ansatz, die Verwicklungen des Lebens zu Papier zu bringen, wechselt die grammatische Person: Aus der Ich- wird eine Duund schließlich eine Er-Erzählung, als ließe sich in jeweils anderer Sicht und Ansprache das eigentlich Gesuchte doch noch fassen. Das alles mag abstrakt und vielleicht etwas blutleer scheinen, gerät bei Altmeister Auster aber wie gewohnt zum vertrackt-spannenden Vexierspiel.
Alles beginnt auf einer Studentenparty in New York im Frühjahr 1967. Adam Walker, der an der Columbia University Literatur studiert, am liebsten aber selbst schon bald als Dichter reüssieren will, lernt einen Gastprofessor namens Born aus Frankreich kennen, dessen Name ihn an einen alten Troubadour erinnert. Darüber kommt man ins Gespräch und trifft sich, wie der Zufall spielt, schon zwei Tage später andernorts erneut. Es folgt eine Einladung zum Essen, die Adam umso lieber annimmt, als sie ihm Gelegenheit zum Wiedersehen mit der Freundin des Professors bietet, einer etwas düsteren Schönheit, die ihm schon auf der Party aufgefallen war. Tatsächlich scheint die Attraktion zwischen den beiden wechselseitig; dazu fordert Born ihn nicht nur beinah unverhohlen auf, eine Affäre mit ihr zu riskieren, sondern macht Adam zugleich das großzügige Angebot, auf seine Kosten eine Literaturzeitschrift zu gründen. Misstrauisch zunächst und völlig unsicher, was für Absichten der rätselhafte Fremde eigentlich verfolgt, gerät Adam doch schnell in den Sog von dessen Reden und lässt sich auf die Aussichten, die er eröffnet, ein - inklusive einer rauschhaften Beziehung mit der Freundin. Und gerade als diese Verwicklungen kulminieren, lernt er Born unvermittelt auch noch anders kennen: als einen brutalen Killer, der eiskalt zusticht.
Hier bricht die Erzählung vorerst ab. Was weiterhin geschieht, wie Adam sich entsetzt von Born abwendet und eine neue Lebensperspektive sucht, wie er ihm in Paris im Herbst desselben Jahres dennoch wiederbegegnet und beschließt, das verlogene Glück, das Born sich offensichtlich gerade aufbaut, durch die Enthüllung seiner Mordtat zu zerstören und wie sich Adam gerade dadurch immer mehr in einem Netzwerk undurchsichtiger Machenschaften verfängt - all das erfahren wir in zwei neuerlichen Ansätzen zum Schreiben sowie einem späteren Nachsatz, wenn der Freund nach Adams Tod versucht, die Geschichte aus den Hinterlassenschaften und dem Zeugnis Hinterbliebener zu bergen.
Dabei verschiebt sich allerdings nicht nur die Perspektive; auch der Fokus des Erzählens geht fast unmerklich auf immer andere Rätselhaftigkeiten über: Ob Adam wirklich Zeuge eines Mordes wurde, ob ihn Born oder dessen Freundin sexuell verführen wollten, ob er selbst eine Achtzehnjährige verführen kann, um sich an Born zu rächen, und ob er überhaupt je mit der Schwester seine hemmungslose Lust auslebt, ist daher letztlich ungewiss. Die Wahrheit des Erzählten bleibt verborgen.
Stattdessen sind wir ständig den Versionen ausgeliefert, die ein professioneller Autor aus den Aufzeichnungen und Erzählungen, die ihm übermittelt werden, wie ein treuer Eckermann bearbeitet und für den Druck herausgibt. Ganz zum Schluss folgt doch noch eine völlig überraschende Enthüllung, die aber weniger die alten Rätsel auflöst als vielmehr noch ein neues stellt. So verbindet sich die literarische Collage - Auster kombiniert Formen des Briefromans, der Tagebuchaufzeichnung und der bekannten Herausgeberfiktion mit einer Vielzahl weiterer Anspielungen, nicht zuletzt auf sein eigenes Werk - abermals mit der Spurensuche eines klassischen Detektivs, der aus nichts als allerhand Indizien und den Aussagen von zweifelhaften Zeugen einen Fall rekonstruieren muss, doch letztlich seine Hoffnungen auf halbwegs sicheres Terrain verliert: "Jeder würde in ihrer Situation lügen, alle würden lügen. Lügen wären die einzige Möglichkeit." Zugleich aber sind Lügen, wie man weiß, seit jeher ein Grundstoff des Erzählens.
Gewiss, dergleichen hat man oft gehört und oft gelesen, und auch die Postmoderne, die uns das immer wieder gerne ins Gedächtnis rief, ist längst schon in den Jahren. Aber wer auf Neues aus ist, sollte Paul Auster ohnehin strikt meiden. Denn seine ganze Kunst liegt darin, Altbewährtes einer neuen Probe auszusetzen und Fund- wie Bruchstücke der Tradition in immer weiteren Mustern anzuordnen, wie um herauszufinden, wozu sie uns noch taugt. So auch jetzt in seinem siebzehnten Roman. Wer sich als Leser von Geschichten am liebsten ganz darin verliert und im Erzählten das Erlebte sucht, wird "Unsichtbar" verstörend, ja verdrießlich finden. Dagegen folgt die wahre Lust dieser Lektüre - ganz wie bei jeder prickelnden Affäre - aus der Distanz, in die das heiß Begehrte immer wieder rückt. Der Kitzel liegt im fortwährenden Hoffen und Erahnen; das Machtvolle bleibt unsichtbar.
Paul Auster: "Unsichtbar". Roman. Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz. Rowohlt Verlag, Reinbek 2010. 320 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Routiniert bespricht Hubert Winkels einen anscheinend ebenso routinierten neuen Auster-Roman. Dieser Roman, lesen wir beispielsweise, sei genauso halbseiden, so spannend wie akademisch, unentschieden zwischen Suspense-Dramaturgie und poetologischem Rätsel wie andere Auster-Romane auch. Nur mit den Sexszenen sei es diesmal anders, da es sich um Inzest handele, was Winkels als Tabuüberschreitungsversuchs aber eher "angegraut" findet. Insgesamt kommt ihm diese Geschichte wie eine Art postmodernes "Wälsungenblut" vor, leicht eklektizistisch, mäßig fesselnd. Erst am Ende kommt Intensität auf, wie Winkels schreibt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Paul Austers 13. Roman zeigt den Meister des intelligent mysteriösen Suspense auf dem Höhepunkt seiner Kunst. Der Tagesspiegel