Nicht lieferbar
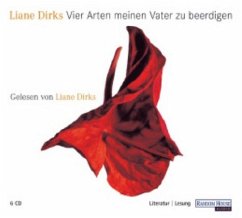
Vier Arten meinen Vater zu beerdigen
Gelesen von der Autorin
Nicht lieferbar
Wie beschreibt eine Frau den sexuellen Missbrauch durch den eigenen Vater? Anklagend, mitleiderregend, als Betroffenheitsbericht? Man kann seinem Vater auch ein literarisches Begräbnis graben. Liane Dirks ist das in ihrem Roman "Vier Arten meinen Vater zu beerdigen" ohne Hass oder Schuldzuweisung gelungen. Über ihn zu erzählen, ihn sogar beim Namen zu nennen, das ist eine der vier Arten, diesen Vater endgültig zu beerdigen. Ihr gelingt es, Verständnis für die Tat des Vaters zu wecken, indem sie dessen Lebensgeschichte von Geburt an erzählt. Denn kein Kind käme mit einem Schild auf der Stirn zur Welt, auf dem stünde: "Ich werde Sexualstraftäter". Es sei einfach eine Entwicklung, so die Autorin in einem Interview.
Ein karibisches Bestattungsritual bildet in diesem Roman von Liane Dirks den Anlass, um die Geschichte eines leidenschaftlichen und getriebenen Mannes zu erzählen. Die Tochter ergründet sein exzesshaftes Leben - schutzlos, einfühlsam und hochpoetisch. Das Hamburg der zwanziger Jahre entdeckt Swing, Freikörperkultur und Ausdruckstanz, als Günther Dirks im elterlichen Schönheitssalon aufwächst, behütet von einem karibischen Kindermädchen. Die Mutter kreiert Düfte und Cremes, der Vater geht ins Bordell, Günther wird Jungkoch in einem Nobelhotel. Dann kommt der Krieg und führt ihn an die Ostfront, von der er mit falscher Identität bis nach Marseille flieht. Günther gründet eine Familie und nimmt sie mit nach Barbados, ins Hotel Marine. Als genialer Küchenchef und begnadeter Geschichtenerzähler mehrt er den Ruhm des weltbekannten Hauses. Doch seit seiner Jugend ist etwas in ihm, das ihn beherrscht. Der Zwang, zum Äußersten zu gehen, der vor nichts Halt macht, auch nicht vor seinen Töchtern. Ein verheerender Hurrikan treibt die Familie zurück nach Deutschland. Dann verschwindet der Vater. Jahre später erfährt die Tochter, dass er auf Barbados im Sterben liegt. Was folgt, ist eine atemberaubende Wiederbegegnung und der Anfang eines rückhaltlosen Erzählvorgangs. Liane Dirks erzählt eine abgründige Geschichte in atmosphärischer Dichte, bildlicher Fülle und sprachlicher Präzision, die den Leser verführt und hineinzieht in ein exzesshaftes Leben.



