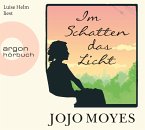Selma, eine alte Westerwälderin, kann den Tod voraussehen. Immer wenn ihr im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf. Unklar ist allerdings, wen es treffen wird. Davon, was die Bewohner in den folgenden Stunden fürchten, was sie blindlings wagen, gestehen, verschwinden lassen oder in Ordnung bringen, erzählt Mariana Leky in ihrem Roman - und natürlich noch viel mehr. "Was man von hier aus sehen kann" ist das Porträt eines Dorfes, in dem alles auf wundersame Weise zusammenhängt. Aber es ist vor allem ein Buch über die Liebe im Modus der Abwesenheit.
»Was man von hier aus sehen kann ist so unterhaltsam und märchenhaft und von einer so großen Weisheit und Tiefe, dass ich unbedingt damit zu tun haben wollte. Es gibt ganz wenige Bücher bei denen mir das passiert.« Sandra Hüller
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
»Was man von hier aus sehen kann ist so unterhaltsam und märchenhaft und von einer so großen Weisheit und Tiefe, dass ich unbedingt damit zu tun haben wollte. Es gibt ganz wenige Bücher bei denen mir das passiert.« Sandra Hüller
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

© BÜCHERmagazin, Ann-Kathrin Maar (akm)
»Eines der schönsten Bücher, die ich im vergangenen Jahr gelesen habe.« Bettina Böttinger, WDR KÖLNER TREFF »Leky lässt die Zügel ihrer Fantasie schießen und schafft es dank ihres disziplinierten Schreibstils, der deutschen Provinz ein wenig von der Magie von Gabriel García Márquez' Macondo einzuhauchen.« Denis Scheck, DRUCKFRISCH »Das hat fast etwas von einem Märchen. [...] Ein schönes Buch.« Thomas Schindler, ARD MOMA »'Was man von hier aus sehen kann' hat alles, was ein Buch braucht: eine feine, kunstvolle und trotzdem schlichte Sprache und eine versponnene Geschichte voller Humor, Liebe und Trauer. « Bettina Tietjen, ZEIT WAS WIR LESEN »Das Buch hat viele Herzen von tollen Buchhändlern für sich eingenommen.« Dorothee Junck, ARD MOMA »Ihre Bücher sind so feinsinnig und unaufgeregt, dass man sich sofort in die Charaktere verliebt - und ein bisschen auch in die Autorin.« FREUNDIN »Ein schön schräger Heimatroman.« Denis Scheck, DRUCKFRISCH »Ein herzerwärmendes Buch, das manchmal wie ein Märchen klingt, und dem Leben, der Welt und der Liebe verhaftet bleibt.« BR WEIBER DIWAN »'Was man von hier aus sehen kann' von Mariana Leky ist ein wirklich wunderbarer, warmherziger, ergreifender, toller Roman.« Ildikó von Kürthy, SWR1 BUCHTIPPS »Wunderbarer Sound. Feiner Humor. Viele kluge, warmherzige Gedanken zum schweren Thema Tod und Verlust. Ein Buch, das einen über die dunklen Tage bringt.« Volker Königkrämer, STERN »Dieser gewitzte Heimatroman lässt ein Okapi durch die Nachtvisionen einer Westerwaldbewohnerin spuken.« SPIEGEL »Mariana Lekys 'Was man von hier aus sehen kann' gehört zu den Büchern, die man noch Stunden und Tage nach der Lektüre verzückt und staunend anstarrt und eigentlich immer bei sich tragen will.« Barbara Weitzel, WELT AM SONNTAG »Lekys Buch ist originell und schräg, vordergründig vor allem heiter, es steckt aber voller Melancholie und Lebensweisheit.« Silke Hellwig, BREMER NACHRICHTEN »Eine großartige Geschichte!« Andrea Braunsteiner, WOMAN »Das ist ein wunderbares, kluges, amüsantes, tiefsinniges Buch.« Manuela Reichart, DEUTSCHLANDFUNK KULTUR »Ein leichtes und originelles Buch, dessen Gewicht trotzdem nicht zu unterschätzen ist.« Claudia Voigt, LITERATURSPIEGEL »Es [ist] Mariana Leky gelungen, mit 'Was man von hier aus sehen kann' wohl eines der beglückendsten Bücher des Jahres zu schreiben. [...] Auf jeder Seite sind mindestens drei Sätze, die man anstreichen, abschreiben oder jemandem vorlesen möchte.« Judith Liere, STERN »Schmerz und Tod und Liebe sind in diesem Buch eng miteinander verflochten.« Jörg Magenau, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG »Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Buch schon verschenkt habe, weil ich es so gerne mag.« Luzia Braun, ZDF Blaues Sofa »Mariana Leky ist die Skurrilitätsbeauftragte der deutschen Gegenwartsliteratur.« Jörg Plath, DLF Kultur »Eines der besten Bücher dieses Jahres« Nicola Steiner, SRF 1 BuchZeichen »Das ist vielleicht ein schönes Buch [...] Das müssen sie lesen! Es ist eines der liebevollsten und komischsten Bücher seit langem.« Elke Heidenreich, WDR4 »Bei diesem Roman habe ich mich jeden Abend gefreut, ihn weiterlesen zu dürfen.« Daniela Thiele, FLOW »Die Stimmung in diesem Buch ist märchenhaft, fantastisch und herzerwärmend.« Susanne Lenz, BERLINER ZEITUNG »Sie schafft ein Literaturkunstwerk, das etwas auslöst, was nur wenigen Büchern gelingt: Es macht glücklich.« Melanie Brandl, MÜNCHENER MERKUR Mariana Leky kreiert in 'Was man von hier aus sehen kann' eine eigenständige, wundersame Welt - auch sprachlich.« Jacqueline Thör, DIE ZEIT »Ich habe selten ein Buch erlebt, in dem so ein empathisches, trauriges, lebensweises Gefühl zwischen den Zeilen mitschwang.« Benedict Wells, MONSIEUR »Es ist eines der ganz wenigen Bücher, die ich gleich nochmal lesen würde.« Jörg Petzold, FLUX FM »[Das Buch] hat etwas Wärmendes, zu Herzen gehendes in der Schwere der Themen, die es behandelt.« Jörg Magenau, RBB KULTURRADIO »Ein skurriles Porträt über die Irrungen und Wirrungen eines Dorfes im Westerwald.« FOCUS »Ich hab mich regelrecht verliebt in diese Leute im Dorf.« Nicola Steiner, SRF Literaturclub »Die Erzählmelodie ist wunderschön. So habe ich das eigentlich noch nie in einem Buch gelesen.« Stina Werenfels, SRF Literaturclub »Hinreißend, aber unaufdringlich. [...] Was mich an diesem Roman hält, ist der zauberhafte Stil. Das ist ein Triumph der Literatur.« Rüdiger Safranski, SRF Literaturclub »Das ist ein zaubervolles Buch, das die Provinz liebevoll auf den Arm nimmt.« Marianne Sax, THURGAUER ZEITUNG »Ein berührender Roman, der den Leser abwechselnd lachen und weinen lässt.« Maria Stich, MITTELBAYERISCHE ZEITUNG »Ein sympathischer, lebenssatter, gekonnt erzählter Roman.« Manuela Reichardt, WDR 3 GUTENBERGS WELT »Magischer Realismus in einem Dorf im Westerwald« Denis Scheck, ARD DRUCKFRISCH »Ein Meisterwerk!« Ariane Heimbach, BRIGITTE WOMAN »Eine Geschichte, in der man sich auch in den traurigsten Momenten so geborgen fühlt wie in der Lieblingsstrickjacke.« Susanna Wengeler, BUCHKULTUR »Auf jeden Fall ein neues Lieblingsbuch.« Britta Heidemann, WAZ »Von Berlin-Mitte oder Manhattan lässt es sich leicht erzählen. Doch manchmal ist es reizvoller, die tiefe Provinz zu erkunden, um etwas über die Menschen zu erfahren.« Rainer Moritz, CHRISMON »'Was man von hier aus sehen kann' ist absolut lesenswert. Ein Fest für alle Menschen, die die leisen Töne lieben und die vielen Möglichkeiten, die Worte und Text der Phantasie zu bieten haben.« David Mesche, Buchbox! Berlin, für die Jury des »Lieblingsbuches der Unabhängigen« »Leky hat - wie John Irving als Vorbild - ein wunderbares Talent für Menschen mit Tics und Marotten, mit besonderen Gaben und bizarren Ritualen, die doch alle im Alltagsleben gründen. Man muss sie einfach gernhaben.« Wolf Ebersberger, NÜRNBERGER ZEITUNG »Mit ihrem dritten Roman ist die gebürtige Kölnerin Leky, Jahrgang 1973, offenkundig angetreten, nicht nur der Figur der Großmutter, sondern auch dem literarisch unterbelichteten Westerwald die verdienten poetischen Denkmäler zu setzen.« Julia Schröder, STUTTGARTER ZEITUNG »Dies ist ein Roman, der auf ganz leisen Sohlen angeschlichen kommt, um einen fest zu packen und dann bis zum Schluss nicht mehr loszulassen. [Nach der Lektüre] vermisst man die Gestalten aus Lekys Buch, weil sie trotz aller Fantastik des Romans so echt wirken, wie man es selten in der Literatur antrifft.« Meike Schnitzler, BRIGITTE »Ein hinreißender Roman über Leben, Lieben, Sterben und Hoffen.« Anita Lehmeier, STYLE »Mariana Leky schreibt, als hätte sie sich jedes Wort neu ausgedacht und dann daraus mal kichernd, mal sanft Sätze gebaut.« Andrea Huss, EMOTION »Zum Lachen, zum Weinen, zum wieder an die Liebe glauben! Eine wunderliche und wunderbare Mischung aus Anna Gavalda und Alina Bronsky, der unkitschigste und dennoch romantischste Liebesroman des Sommers!« Karla Paul, ARD Buffet »Ein Buch, das mit seinem bedächtigen Witz höchst tröstlich wirkt [...] und das zum Wiederundwiederlesen ins Regal gehört.« Britta Heidemann, WAZ »[Lekys außergewöhnliche Sprache] ist überraschend, komisch, voller unerwarteter Verknüpfungen.« Claudia Lehnen, KÖLNER STADT-ANZEIGER »Skurril, phantastisch, aber ungemein liebevoll erzählt die deutsche Autorin Mariana Leky ihre Dorfgeschichten.« Karin Waldner-Petutschnig, KLEINE ZEITUNG »Das skurrile Porträt der Dorfgemeinschaft lässt einen nicht mehr los. Ein kluger Roman, bei dem man lachen und weinen kann.« Jessica Will, RUHR NACHRICHTEN »Sprachlich brillant« HAMBURGER MORGENPOST »Es ist eines dieser Bücher, die glücklich machen können. Niemals kitschig, niemals oberflächlich. Klug und einfühlsam und mit glühender Liebe zur Sprache.« Bianca Schwarz, HR2 KULTUR »Das Buch hat alles. Es ist witzig, traurig, und die Autorin geht sehr liebevoll mit den Charakteren um, die sie beschreibt.« Florian Langhoff, RP-ONLINE »Lesen sollte man es vor allem, um sich von Mariana Lekys grandioser Sprachkunst immer wieder überraschen zu lassen.« Katharina Mahrenholtz, NORDDEUTSCHER RUNDFUNK »Ein empfehlenswertes Buch über ein Dorf im Westerwald und auch darüber, dass man im rechten Augenblick nie sagen kann, was man sagen müsste.« Jörg Plath, DEUTSCHLANDFUNK KULTUR Lesart »Lesen sollte man [das Buch] vor allem, um sich von Mariana Lekys grandioser Sprachkunst immer wieder überraschen zu lassen.« Katharina Mahrenholtz, NDR KULTUR »Ein Buch, das man jedem in die Hand drücken möchte, einfach, weil es so hinreißend ist!« Johanna Siebert, BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG »Wahnsinnig poetisch [...]. Ein Märchen für Erwachsene.« Petra Hartlieb, ORF FERNSEHEN heute leben »Selten habe ich ein gleichzeitig so lustiges wie tiefgründiges Buch gelesen. Solche Bücher sind rar. Sie lassen einen über die Seltsamkeiten und kleinen Wunder des Lebens nachdenken - wie der Anblick eines Okapis.« Thomas Böhm, RADIOEINS Die Literaturagenten »Gönnen Sie sich etwas Gutes.« Gérard Otremba, SOUNDSANDBOOKS.COM »'Was man von hier aus sehen kann' von Mariana Leky; bis jetzt eines der besten Bücher des Jahres.« Kirsten Guthmann, RADIO 91.2
»Das ist ein wunderbares, kluges, amüsantes, tiefsinniges Buch.« Deutschlandfunk Kultur