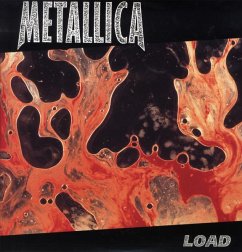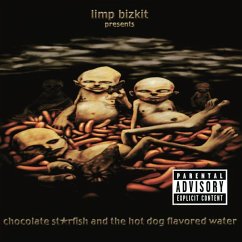LP 1
1
That Was Just Your Life
00:07:10
2
The End Of The Line
00:07:52
3
Broken, Beat & Scarred
00:06:27
4
The Day That Never Comes
00:07:57
5
All Nightmare Long
00:08:01
LP 2
1
Cyanide
00:06:41
2
The Unforgiven III
00:07:47
3
The Judas Kiss
00:08:02
4
Suicide & Redemption
00:10:02
5
My Apocalypse
00:05:01