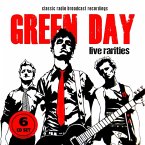Produktdetails
- Anzahl: 1 Vinyl
- Erscheinungstermin: 16. Mai 2014
- Hersteller: Warner Music,
- EAN: 0825646298815
- Artikelnr.: 40739947
- Herstellerkennzeichnung
- Warner Music
- Warner Music Group Germany Holding GmbH
- Alter Wandrahm 14
- 20457 Hamburg
- anfrage@warnermusic.com
| LP | |||
| 1 | Always in my head | ||
| 2 | Magic | ||
| 3 | Ink | ||
| 4 | True love | ||
| 5 | Midnight | ||
| 6 | Another's arms | ||
| 7 | Oceans | ||
| 8 | A sky full of stars | ||
| 9 | O | ||

Diese verdammte Lieblosigkeit der Liebe gegenüber: die neue Platte von Coldplay. Weg, weg, weg damit!
Das Leben wird, das kann man zumindest in dieser derart verregneten Jahreszeit zu glauben anfangen, immer belangloser. Fraglos kollabieren in anderen Ländern und Landschaften reihenweise die Existenzen, aber hier, bei uns Kulturbürgern friedlicher Regionen, scheint zumindest öffentlich wenig von großer Konsequenz vorzufallen: Conchita Wurst. Und man soll ja nicht klagen, aber irgendwas Aufregenderes wäre vielleicht mal schön.
Zum Glück sind wir nicht allein soziale und politische, sondern auch private Wesen. Die persönlichen Ereignisse können das Leben jederzeit ins Erschütternde übergehen lassen. Der Tod und die Liebe bleiben als Großmächte auch in der Bundesrepublik und in Beverly Hills bestehen. Wenn sie in unsere Leben treten, geht uns alles wieder näher. Natürlich kann das dann schwer, sogar entsetzlich sein, aber im Grunde wäre unsere Existenz doch unerträglich, wenn die Ereignisse nicht ab und an echtes Gewicht hätten.
Wenn man die neue Platte von Coldplay hört, kriegt man Angst um dieses Gewicht. Vielleicht ist es nur die verregnete Jahreszeit, aber wirklich, etwas so Sinistres, alles Relevante systematisch in brutalste Banalität Hinabziehendes hat man schon lange nicht mehr gehört. Diese Platte stimmt nihilistisch.
Es geht darauf, so ballert es aus allen verfügbaren Kanälen einer gewaltigen Hochglanz-PR-Maschine, um Liebeskummer in existentiellen Dimensionen. Ohne falsche Scham bekennt der Coldplay-Sänger Chris Martin in Interviews und Wikipedia-Passagen, dass die Musik auf "Ghost Stories" seine von allen Boulevardblättern hinlänglich besungene Trennung von der Schauspielerin Gwyneth Paltrow zum Thema habe. "Ghost Stories" ist eine Platte über die in dieser grausamen Welt tatsächlich real vorhandene Möglichkeit, der großen Liebe verlustig zu gehen. Damit ist, und das weiß jeder, der einmal ernsthaften Liebeskummer gehabt hat, nicht ansatzweise zu spaßen. Hier geht es um die bittere Wunde, aus der große Künstler große Kunst geschaffen haben, und das, wie man sich vorstellen kann, unter größten Schmerzen.
Natürlich wollen wir keine Zensur haben - wobei die Einrichtung einer solchen Institution immerhin mal wieder etwas wirklich Aufregendes im öffentlichen Raum bedeuten würde -, aber man muss sich schon fragen, ob diese unsere Kultur nicht aus reinem Selbsterhaltungswillen eine Platte wie "Ghost Stories" verbieten sollte. Wenn schlimmster Liebeskummer von unschuldigen Jugendlichen künftig mit diesem musikalischen Muckefuck (ja, im doppelten Sinne des Wortes) assoziiert wird, so drohen diese unschuldigen Jugendlichen ihrer Fähigkeit zum Schmerz und zur Unmittelbarkeit des Lebens überhaupt beraubt zu werden, und zwar weil sie in dieser Musik auf eine Welt treffen, in der es für das wirklich Heftige keine Formulierungsmöglichkeiten mehr gibt, sondern nur noch einen betäubenden Brei weichgewaschener Tristesse und schalen Trostes.
Natürlich soll man solche Texte wie diesen weder lesen noch schreiben. Schaum vor dem Mund des Rezensenten. Das ist alles viel zu drastisch. Außerdem lassen sich gegen den Inhalt zwei schwere Einwände vorbringen. Erstens: Die Popkultur ist seit Anbeginn von bretthaftiger Flachheit. "I've lost her now for sure, I won't see her no more, It's gonna be a drag, misery!", das haben die Beatles gesungen, und wenn man es hörte, konnte man auch damals nur antworten: Big Deal. Zweitens: Die Coldplay-Platte hat ihre Momente.
Hören und vergessen
Fangen wir mit zweitens an. Die Single, die vorab aus dem Album veröffentlicht wurde, heißt "Midnight" und ist wirklich sehr gut. Es war nicht schwer, den Kopf hinter der Sache herauszuhören, den englischen Produzenten Jon Hopkins, der, wenn man ihn alleine lässt, sehr schöne Platten veröffentlicht, aber auch als Popproduzent tolle Sachen aus den ihm anvertrauten Bands herausholt. Hopkins hat schon früher mit Coldplay zusammengearbeitet, aber bei dieser Single dachte man, die Band würde nun endlich machen, was man als langsam im eigenen Fahrwasser ersaufende Band normalerweise tut, nämlich sich in die Hände eines anderen zu geben und zu schauen, was der dann mit den Ideen anstellt. "Midnight" klingt wie ein Coldplay-Remix, und alles, was an der Band gut war, ihr Sinn für nächtliche Fahrradfahrmomente, für Dahingleiten, unverstellte Süße und Euphorie, ist in dem Song bis aufs Äußerste herausgekitzelt. Ein Wunder, dachte man. Diese Band, die spätestens auf dem dritten Album in einem historischen Versehen skandalösen Ausmaßes in den Stadionrock ausgeglitten war, hatte es irgendwie geschafft, wieder in die Spur zu finden, Hopkins sei Dank, und sich selbst irgendwie wieder an etwas zeitgemäß Klingendes, Subtiles anzudocken. "Midnight" hebt nie wirklich ab, vielmehr hat die Nummer etwas vom Glitzern auf dem Wasser, gegen Ende blendet es fast, aber dann verschwindet es wieder. Sehr schön.
Leider war es das aber auch schon. Was Chris Martin als Songschreiber früher immer konnte, den melancholisch angehauchten Superhaken, die kleine Melodie, die nicht mehr aus dem Kopf verschwindet, egal, wie blöd man sie findet, ist auf "Ghost Stories" höchstens noch in müden Anklängen zu finden. Weil er so viel über die verlorene Liebe erzählt und Gwyneth, kommt man beim Hören der Platte irgendwie nicht umhin, sich den Mann beim Schreiben vorzustellen, und man stellt sich jemanden vor, der in äußerster Sattheit an der eigenen Kunst wie Sisyphos zum Klavier geht, vielleicht aus dem noblen Gedanken heraus, dass die eigene Begabung mit einer Schuld einhergeht, dass man daraus etwas zu machen hat, und dann komponiert er Lieder, die er gleich mit dem Tonband aufzeichnen muss, weil er sie sonst auf der Stelle wieder vergessen würde. Im Grunde klingt die Platte so, als habe man irgendeinem neuen Teufelscomputer von Google alle Coldplay-Platten der Vergangenheit eingespeist, die Musik in Algorithmen verwandelt und die Maschine dann darum gebeten, neue Werke auszuspucken (verbleibende Rechenzeit: 2:38 Minuten).
Lügen und Lügen
Es ist diese Lieblosigkeit der Liebe gegenüber, die Stummheit dieser Musik, gepaart mit den epischen Erzählungen über ihre Entstehung und dem über Sufismus und japanische Keramik als Metaphern daherschwatzenden Chris Martin, die das Ganze so unerträglich und letztlich auch so böse erscheinen lässt. Es gibt Tropen in der Popmusik, dazu zählt ganz massiv der Liebeskummer; und die werden immer wieder bedient und auch immer wieder schamlos bedient. So phantastisch Songs wie Dylans "Don't Think Twice" oder Joy Divisions "Love Will Tear Us Apart" dieses Thema verhandeln, ist es doch sicher, dass sowohl Dylan wie auch Ian Curtis beim Schreiben gewusst haben, dass sie sich in den vorgesteckten Grenzen eines historisch hinlänglich behandelten Genres bewegten, das sie dann mit großen Gefühlen auszukleiden vermochten. Und schamlos machen das natürlich Leute wie zum Beispiel Rihanna oder Lana Del Rey, aber sie machen es ohne dieses Bombardement mit Backstorys, Mystik und tragischem Gesichtsausdruck, und damit auf ihre Art und Weise immer noch ehrlich und unmittelbar. Es ist, wenn man sich deren Nummern anhört, genau wie bei den alten Beatles-Songs unausgesprochen klar, dass es sich hier nicht um Ernst, sondern um Entertainment handelt, oder um die Schulter zum Ausheulen für das weinende Kind.
Coldplay hingegen tragen diese ganze Platte mit einem Gestus bierernster Humorlosigkeit vor, der im Hörer nicht allein Widerwillen, sondern tatsächlich Wut hervorruft. Vielleicht ist das alles total gemein, vielleicht hat Chris Martin wirklich mit sich gerungen und die Songs endlich aus den Tälern seiner tränengetränkten Bettlaken in sein iPhone geschluchzt, aber wenn dem so sein sollte, dann ist unterwegs alle Substanz verlorengegangen, und ganz ehrlich, man glaubt ihm seine Trauer nicht ansatzweise.
Die schönen Gefühle
Vielmehr kann man sich paranoid fragen, wie die Veröffentlichung der privaten Nachrichten den Komplex Martin-Paltrow betreffend bloß so treffend mit einer Platte zu eben jenem Thema koinzidieren konnte. Und wenn sich beide einig gewesen sein sollten, dass man die Trennung sehr werbewirksam kurz vor dem Erscheinen des Albums öffentlich machen sollte, dürfen sie sich nicht wundern, dass andere diese Privatgeschichten dann ebenso schamlos in ihre Bewertung mit einfließen lassen.
Am Ende ist das alles vielleicht viel zu hochtrabend. Die neue Coldplay-Platte ist total belanglos, egal, weg damit, weiter. Aber der Eindruck, dass hier jemand die allerschönsten, traurigsten, wichtigsten Situationen unserer Existenz über riesige Flachbildfernseher in der gesamten Welt jagt, um damit Dünnpfiff zu verticken, kann einen sehr wohl zornig machen, und auch ängstlich, denn natürlich ist im Schmerz immer auch die Möglichkeit zur Reflexion der Welt gegeben, und hier hat man das Gefühl, dass der Schmerz einer computergenerierten Simulation auf der Stufe "Mildly Painful" weichen soll, dass eine zynische Glattbügelung stattfindet, deren leise Bitterkeit die Bitterkeit des vom Markt eingeflößten Morphins ist, mit dem jede menschliche Regung im Nebel enden soll. Diese Musik, um es kurz zu sagen, hat etwas Beunruhigendes, aber vielleicht ist das auch nur die derart verregnete Jahreszeit, vielleicht wäre es einem bei mehr Sonnenschein einfach egal, dass Chris Martins Verzweiflung wie Kodein schmeckt.
ALARD VON KITTLITZ
"Ghost Stories", Parlophone/Warner
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main