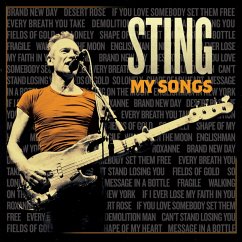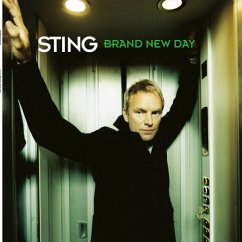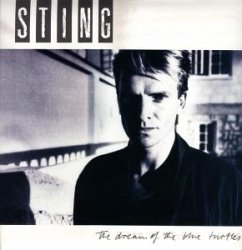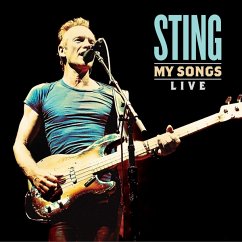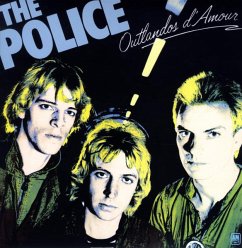LP
1
The Last Ship
00:03:50
2
Dead Man's Boots
00:03:30
3
And Yet
00:03:53
4
August Winds
00:03:18
5
Language Of Birds
00:03:30