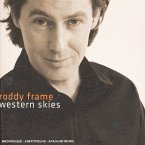Produktdetails
- Anzahl: 1 Audio CD
- Erscheinungstermin: 3. Juli 2021
- Hersteller: Edel Music & Entertainment GmbH / Intuition,
- EAN: 0750447013025
- Artikelnr.: 22913588
- Herstellerkennzeichnung
- Q-Rious Music
- Neue Maastrichter Str. 12-14
- 50672 Köln
- info@qrious.de
| CD | |||
| 1 | Only heaven knows | 00:02:46 | |
| 2 | Cold shoulder | 00:03:08 | |
| 3 | Baby come home | 00:02:35 | |
| 4 | Wide awake | 00:02:54 | |
| 5 | Walk on water | 00:03:14 | |
| 6 | Friends and strangers | 00:03:36 | |
| 7 | Shine a light | 00:03:47 | |
| 8 | Brainstorm | 00:04:31 | |
| 9 | Unfairground | 00:03:50 | |
| 10 | Run run run | 00:03:36 | |

Man könnte ihn einen Wehrdienstverweigerer des Pop nennen: Kevin Ayers, einst ein Star der psychedelischen Musik, hat nach fünfzehn Jahren Pause mit einem großen Alterswerk die Kurve gekriegt.
Neue Alben alternder Musik-Veteranen sind nichts Besonderes. Man kennt das: unvorteilhafte Pflichtübungen, solide Nachreichungen, Bob-Dylan-Platten. Aber ein neues, seligmachendes Album einer Legende, die dem ganzen albernen Musikgeschäft eigentlich längst von der Schippe gesprungen war, kommt nicht alle Tage vor. Und dass ausgerechnet der ewige Pop-Fahnenflüchtige Kevin Ayers noch einmal in die Niederungen des hysterischen Musikbetriebs zurückgekehrt ist, das erstaunt doch sehr.
Zurückgekehrt von wo überhaupt? Das ist es ja gerade: von überall! Aus dem südfranzösischen Exil beispielsweise, wo er es sich in der Hängematte des Rockstar-Ruhestands eigentlich schon gemütlich gemacht hatte. Zurück auch aus der Nische der vergessenen Spätsechziger- und Frühsiebziger-Kultfiguren, denen von haschischumnebelten Liebhabern gestriger Rockmusik ungefragt immer unglaublichere ebenso gestrige Wahnsinnstaten angedichtet werden. Vor allem aber zurück aus der Depression, die ihn lange Jahre so fest im Griff hatte, dass er keine Musik mehr machen konnte. Es grenzt tatsächlich an ein Wunder, dass Ayers, inzwischen dreiundsechzig, nach gut fünfzehn Jahren Album-Abstinenz überhaupt noch einmal die Kurve gekriegt hat. Dass er der Welt auch noch ein spätes, weises Meisterwerk mitgebracht hat, ist sehr freundlich von ihm.
Im Verschwinden war Ayers schon immer gut: Der Brite ist der große Verduftikus der Popgeschichte. Ein Ausbüchser und Dienstverweigerer, der sich, wann immer es mit seiner Karriere ernst wurde, aus Tournee- und Promotion-Pflichten stahl und in die Sonne flüchtete, wo er es sich gutgehen ließ. Und ernst wurde es oft in Karriere-Fragen. Ayers, mit seinem grünen Samtjackett und der Aura eines gut gealterten Hippie-Casanovas ein unverkennbarer Spross der Sechziger, spricht mit demselben unverkennbaren Bariton, der auch seine Singstimme wie dickflüssigen Sirup klingen lässt: "Die Leute fragen immer, warum ich vor dem Erfolg geflüchtet bin. Dabei hatte ich genau so viel Erfolg, wie ich gerade brauchte. Ich konnte immer ausdrücken, was ich fühle, das bedeutet für mich Erfolg. Aber alles, was darüber hinausgeht, brauche ich nicht. Davor bin ich geflüchtet."
Es ist genau diese Leichtigkeit, die auch seine beste Musik auszeichnet. Als junger hübscher Drop-out gründete Ayers mit Robert Wyatt, Mike Ratledge und Daevid Allen 1966 die Prog-Rock-Band Soft Machine, neben Syd Barretts Pink Floyd die wichtigste britische Band jener Ära. Bald schon wurde es ihm bei Soft Machine zu akademisch. Ayers: "Ich habe Lehrmeister immer schon gehasst. Was ich weiß, habe ich mir selbst beigebracht. Ich war damals sehr jung, und ich wusste zum Glück, dass ich gezielt Risiken eingehen musste, solange ich jung war. Ab einem gewissen Alter geht das nicht mehr. Ich wusste, dass ich Songs schreiben konnte, also stieg ich aus und nahm meine erste Solo-Platte auf. Sie hat mir damals alles bedeutet."
Diese Platte, das exzentrische Wunderwerk "Joy Of A Toy" von 1969, muss zum Schönsten gezählt werden, was die britische Pop-Musik der späten Sechziger hervorgebracht hat: naive, großäugige Pop-Songs über Mädchen auf Schaukeln, seltsame Zugfahrten und eine gewisse Eleanor, die von einem Kuchen gegessen wird. Kevin Ayers' Musik war der beinah kindliche Gegenentwurf zu allen grassierenden Prog- und Psych-Exzessen; er gab der psychedelischen Musik die Kindlichkeit zurück, die ihr verlorengegangen war, nachdem Syd Barrett endgültig die Augen nach innen gedreht hatte. Statt ambitioniert die Flügel zu spreizen, veröffentlichte er lieber Singles über Schmetterlinge, den karibischen Mond und pflegte den schrulligen Brauch, auf möglichst vielen seiner Platten das Wort "Banana" unterzubringen. "Mir soll es sehr recht sein", sagt Ayers, "wenn man mit mir eher etwas Positives verbindet, das gefällt mir. Gerade weil es zuletzt bei mir ganz anders aussah . . ."
So erschien in den frühen Siebzigern Album auf Album voll beispielloser Leichtfüßigkeiten, Rotwein-Oden und Haiku-artiger Songs über Schein und Sein - und Bananen. Ayers' Plattenfirmen aber wollten aus dem gutaussehenden Schwerenöter berechtigterweise einen Star machen. Meistens gelang es Ayers, einfach auszubüxen. Er brach Tourneen ab oder war einfach unauffindbar. Ab Mitte der Siebziger aber begann er nachzugeben. "Ich habe damals auf zu viele Leute gehört, entsprechend schlecht sind meine Platten ab Mitte der Siebziger dann auch geworden", sagt er mit gerade so viel Bedauern, dass man ihm keine Gleichgültigkeit unterschieben kann.
In den Achtzigern ging er dann in Spanien verloren, später verschlug es ihn nach Montlieu, einem Dorf im Südwesten Frankreichs. Die Platten wurden immer seltener (und nicht eben besser). Eine letzte erschien 1992, dann war nichts mehr zu hören. "Ich war schwer depressiv und habe lange Jahre Psychopharmaka eingenommen", sagt Ayers und guckt kurz unsicher, als wolle er wissen, ob er mit dieser Information zu ungeschützt umgeht. "Ich konnte an nichts Angenehmes mehr denken - weder an Sex noch an Musik. Aber es musste etwas passieren, sonst hätte ich mich gleich beerdigen lassen können."
Und es passierte etwas: ein neues Album. Geburtshelfer dieser Platte war der amerikanische Künstler Tim Shepard, der Ayers auf einer Kunstausstellung kennenlernte und Freundschaft mit ihm schloss. Erst Jahre später fand er über Dritte heraus, dass der kunstsinnige Hippie mal ein Popstar gewesen war, Ayers hielt es typischerweise für nicht weiter erwähnenswert. Als Ayers seinem Freund vor zwei Jahren ein paar neue Songs vorspielte, organisierte der kurzum die Aufnahme der neuen Platte und trommelte unzählige musizierende Ayers-Fans (von Teenage Fanclub über Architecture in Helsinki bis zu Roxy Music-Gitarrist Phil Manzanera) als Backing Band zusammen. Das Ergebnis, "The Unfairground" betitelt, ist eine luftige, gelassene Platte über das Altern. Das Hängematten-Gegenstück zu Dylans "Time Out Of Mind".
Gleichzeitig nebensächlich und unglaublich prägnant klingen diese Stücke, wie mit den Füßen im Sand und den Gedanken bei der Liebsten gespielt. "What do you do when it's all behind you?", croont er im Eröffnungs-Song zu munterem Mariachi-Gebläse. Fühlt er sich wohl mit seinem Alter? Ayers lacht: "Ich muss wohl. Künstlerische Arbeit hilft, auch wenn der Körper dich langsam im Stich lässt. Beantwortet das die Frage?"
Einen Brandy und viele Anekdoten später beantwortet Ayers die Frage indirekt noch einmal anders: "Weißt du, ich komme aus einem tiefen Loch, ich war so gut wie tot. Die Depression und all die fürchterlichen armseligen Live-Shows der Neunziger waren die Hölle. Zum Glück habe ich einen enormen Überlebensgeist, eine positive Seite, die stärker ist als alle Düsternis. Ich war noch nicht bereit zu sterben, und ich wollte der Welt noch einmal zeigen, was in mir steckt." Zum wahrscheinlich ersten Mal in seinem Leben hat Kevin Ayers seine ambitionierte Seite entdeckt. Sie hat ihm das Leben gerettet.
ERIC PFEIL
Kevin Ayers, The Unfairground. Tuition Records 130 (Alive)
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main