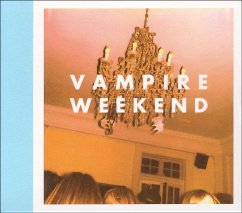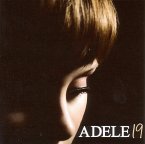Produktdetails
- Anzahl: 1 Vinyl
- Erscheinungstermin: 17. Januar 2014
- Hersteller: 375 Media GmbH / XL/BEGGARS GROUP / INDIGO,
- EAN: 0634904031817
- Artikelnr.: 23409819
- Herstellerkennzeichnung
- Beggars UK Ltd.
- 375 Media GmbH
- Schachthofstraße 36a
- 21079 Hamburg
- 375media.com
| LP | |||
| 1 | Mansard Roof | 00:02:07 | |
| 2 | Oxford Comma | 00:03:15 | |
| 3 | A-Punk | 00:02:17 | |
| 4 | Cape Cod Kwassa Kwassa | 00:03:33 | |
| 5 | M79 | 00:04:14 | |
| 6 | Campus | 00:02:55 | |
| 7 | Bryn | 00:02:12 | |
| 8 | One (Blake's Got A New Face) | 00:03:11 | |
| 9 | I Stand Corrected | 00:02:38 | |
| 10 | Walcott | 00:03:39 | |
| 11 | The Kids Don't Stand A Chance | 00:04:03 | |

Ein sicheres Mittel gegen die grassierende Popmüdigkeit: Das Erfrischende am Debütalbum von Vampire Weekend aus New York ist, dass es auf ihre vielfältigen Einflüsse gar nicht ankommt.
Es muss hier endlich von einem Tabu berichtet werden. Einem popmusikjournalistischen Tabu, um genau zu sein: so undenkbar, monströs und beängstigend, dass man sich selbst befreundeten Musikschreibern im vermeintlich sicheren Rahmen eines Thekengesprächs niemals offenbaren könnte. Es geht keinesfalls um schrullige Lappalien wie eine geheime Vorliebe für christlichen Achtziger-Jahre-Hardrock. Es geht um ein echtes Problem: Popmusikverdrossenheit.
Unzählige mit Popular-Musik befasste Autoren über dreißig kennen die Situation, flüchten sich aber eher ins Leugnen, anstatt zu bekennen: Tagtäglich trudeln auf ihren Schreibtischen unzählige Bemusterungsexemplare mit vermeintlich neuer Musik ein; die CD-Stapel auf Schreibtischen und Fensterbänken wachsen stetig. Allein: Keine dieser Platten vermag echte Begeisterung auszulösen - was ja zunächst noch kein Drama sein muss: Erstens kann man ja stattdessen alte Musik hören ("Ich entdecke gerade Bob Seger, toll, wie man sich so spät noch für etwas begeistern kann, was einem vorher schnurz war") oder sich in ausgeblichene Sub-Genres vergangener Zeiten hineinsteigern. Zudem kann man ja auch Sachen "relativ gut" finden und sie eben im Kontext ihrer Zeit loben und bejubeln: "Und hier die nächsten neuen Smiths."
Theater-, Literatur-, Film- und Tischtennis-Journalisten können sich problemlos auf den gemütlichen Standpunkt zurückziehen, der künstlerische Nachwuchs befände sich in einer Krise, Tabori/Fauser/Antonioni/Bollershagen hätten das alles einfach schon einmal besser - und vor allem: ansteckender - gemacht. Doch der Musikschreiber kann sich Kulturpessimismus nicht im Ansatz leisten. Kickt es ihn nicht mehr, dann ist er draußen. Das ist nur gerecht so - so will es die Pop-Logik bis heute. Zwar ließe sich aus dem Ekel allen neuen Platten gegenüber sicherlich für eine Weile eine Pose machen. Nur: Wie lange funktioniert das, ohne dass es alle nervt? Zudem: Es geht ja auch gar nicht so sehr um den öden besserwisserischen Vorwurf, alles sei schon einmal da gewesen. Es geht einfach ganz stumpf darum, dass einem nichts mehr gefällt.
So weit das Problem. Was aber hilft? Lange Spaziergänge? Eine neue Hose? Eine Umstellung der Lebensgewohnheiten? Was einen schließlich, nun ja, nicht rettet, aber doch zumindest Hoffnung schöpfen lässt, ist am Ende dann doch letztlich wieder einfach nur - Musik. Eine Band, eine Platte, die den Finger auf einen lange nicht gedrückten Knopf legt. Willkommen zurück.
Die Erlöserband, um die es hier geht, heißt Vampire Weekend. Sie wird derzeit allerorts viel gelobt und bejubelt, wie man das eben so macht mit jungen Bands. Die vier Mitglieder kommen aus Brooklyn, New York, haben die handelsüblichen Instrumente umhängen, sind jung und aufgedreht, auch das kennt man alles. Der halbwegs in erfreulicher Vergessenheit versunkene Chris Martin findet sie toll, David Byrne ist auch begeistert, und im Internet drehen sie ohnehin alle durch. Was Vampire Weekend für viele so grundsätzlich anders macht, ist die Tatsache, dass die Band keinen verzerrten Bettlägerigen-Rock oder irr zuckenden Post-Punk spielt, sondern in ihrer Musik sorglos Elemente afrikanischer Highlife- oder Juju-Musik verarbeitet.
Ohne diese Einflüsse unter den Tisch fegen zu wollen, muss einmal klar gesagt werden: Vampire Weekend sind nicht so toll, weil sie afrikanische Elemente verbraten, sondern weil es so völlig egal ist, dass sie das tun. Weil es etwas anderes ist, was ihre knapp fünfunddreißig Minuten dauernde Platte so gut macht: Ihre Musik erzählt frühlingsleicht von Möglichkeiten, anstatt mit Unmöglichkeiten zu hantieren. Die afrikanischen Elemente beeinflussen das Songwriting letztlich kaum: Die Songs klingen vertraut. So vertraut wie eben auch ein Glas Wasser in der Wüste schmeckt. So eindeutig und erfrischend der Einfluss afrikanischer Musik auf Rhythmik und Gitarrenspiel ist, so sehr wird die Musik auch vom Chamber-Pop der Sixties (The Zombies, The Left Banke) beatmet. Die Verbindung beider Klangwelten mit einem unbeschwert studentischen Gestus macht am Ende den Reiz aus.
Man höre nur den Opener "Mansard Roof": Donauwellen-Keyboards, Moskito-Gitarren, Streicher, die am Vorabend ein meet&greet mit Van Dyke Parks hatten und ein unbeholfen tänzelndes, staubtrockenes Schlagzeug umspielen eine herrliche Flausen-im-Kopf-Melodie. Bei "M79" klingen Vampire Weekend dann wie der Soundtrack zu einem Wes-Anderson-Film über eine Studententruppe, die um 1967 in Nigeria die übernatürlichen Kräfte der Juju-Aura erforscht; im Text geht es um einen Ritt auf einem Raketenwerfer, vermutlich ein Liebeslied. Und "Cape Kod Kwassa Kwassa" führt vor, wie es sich anhört, wenn sich vier junge New Yorker auf Paul Simons "Graceland" als Lieblingsplatte einigen können. Dazu singen Vampire Weekend die verqueren Zeilen: "But this feels / So unnatural / Peter Gabriel too". Aber auch: "Can you stay up / To see the dawn / In the colors / Of Bennetton?".
Ein magisches Debüt: unschuldig, einfältig und sorglos - und gleichzeitig doch clever, durchtrieben und ironisch. Eine Sonne in der Nacht, um es mit Peter Maffay zu sagen. Ein hübscher Nebeneffekt an Vampire Weekend ist, dass ihr Ausnahmealbum zeigt, dass der Popekel der letzten Zeit begründet war. Ob nun seit dem Frühwerk der Shins oder den letzten Großtaten der Flaming Lips: Lange gab es keine so positive und mitreißende Band mehr zu hören.
ERIC PFEIL
Vampire Weekend, Vampire Weekend. XL Recordings/Beggars 318 (Indigo)
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main