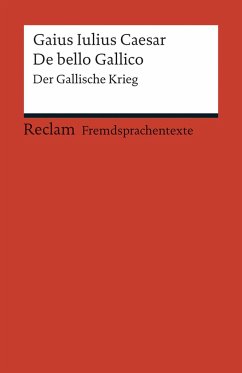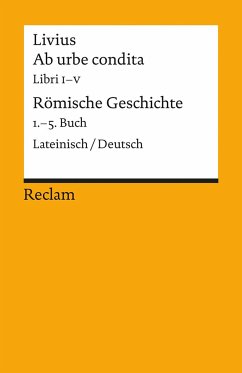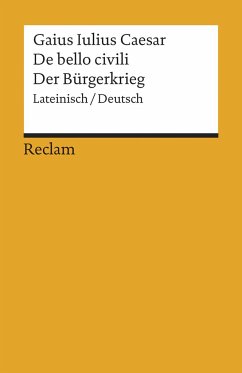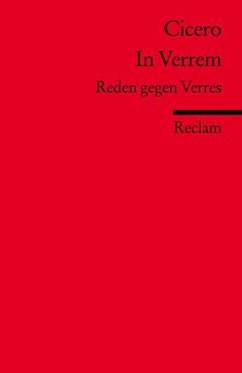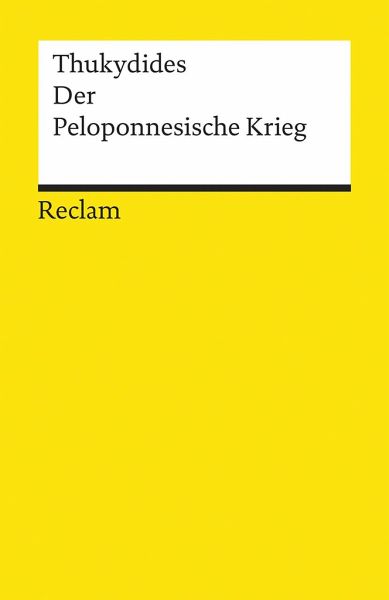
Thukydides
Broschiertes Buch
Der Peloponnesische Krieg
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Die acht Bücher über den Peloponnesischen Krieg gelten als das bedeutendste Geschichtswerk der antiken Literatur. Sein Einfluss, zunächst auf die römischen Historiker, dann auf die gesamte europäische Geschichtsschreibung, war enorm. Mit unbestechlichem Blick erkennt Thukydides die Stärken und Schwächen der Verantwortlichen für diesen ganz Griechenland erschütternden Krieg und die zweifelhaften Mechanismen der Politik.Diese vollständige Ausgabe ersetzt die bisherige Auswahlausgabe.
Thukydides wurde um 460 v. Chr. in Athen geboren. Er war vertraut mit dem Werk Herodots, dessen Vorlesung er selbst beiwohnte. Später war er im attischen Militär als General tätig. 424 v. Chr. nahm er als Flottenkommandant am Peloponnesischen Krieg (431-404) teil. Da er den Fall der Stadt Amphipolis an den spartanischen Feind nicht verhindern konnte, wurde er für 20 Jahre aus Athen verbannt. Sein Exil verbrachte er in Thrakien, wo er den Verlauf des Krieges genau beobachtete und analysierte. Auf diese Weise schuf Thukydides sein umfangreiches Geschichtswerk. Nach Ende des Peloponnesischen Krieges (404 v. Chr.) kehrte er vermutlich nach Athen zurück, wo er um 400 v. Chr. verstarb.
Produktdetails
- Reclams Universal-Bibliothek 1808
- Verlag: Reclam, Ditzingen
- 2000.
- Seitenzahl: 851
- Erscheinungstermin: 15. Januar 2000
- Deutsch
- Abmessung: 145mm x 95mm x 38mm
- Gewicht: 330g
- ISBN-13: 9783150018088
- ISBN-10: 3150018080
- Artikelnr.: 08950812
Herstellerkennzeichnung
Reclam Philipp Jun.
Siemensstr. 32
71254 Ditzingen
auslieferung@reclam.de
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Alles Schwachsinn, sagt Jens Jessen, dass man kiloweise nur leichte Lektüre in den Urlaub mitnehmen sollte. Wann habe man schon mal den Kopf so frei, um sich auch vertrackteren Texte zuzuwenden, fragt er und empfiehlt eine kleine handliche Ausgabe von Thukydides' "Der Peleponnesische Krieg", der selbst in der Übersetzung zugegebenermaßen nicht einfach zu lesen sei. Niemand werde nach dieser Lektüre die Griechen, die sich mit ihrer Konkurrenzpolitik gegen Sparta in einen dreißigjährigen Bürgerkrieg verwickeln ließen, weiterhin für ein vorbildliches Volk halten, meint Jessen. Darüber hinaus gewähre der antike Text aber vor allem Einblick in die politische Dynamik der Macht, so der Rezensent, die Parallelen Athen - USA mit ihrem Kampf gegen den Terrorismus drängten sich geradezu auf. Defensive Expansion, Export der eigenen Staatsform, politische Erziehung, Freiheitsrhetorik, Hegemonialanspruch, Verschränkung von Innen- und Außenpolitik, historisch-moralische Erpressung der befreundeten Staaten, das Recht des Stärkeren als Naturgesetz, all das lasse sich in seiner eiskalten Logik schon bei Thukydides nachlesen, der klarsichtig die wahre Natur des Menschen und des Krieges erkannt habe. Man wundere sich nicht mehr, schließt der Artikel, warum sich die Amerikaner nicht in multilaterale Verträge einbinden lassen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Zu den unvergänglichen Vorurteilen zeitgenössischer Lebenspraxis gehört die Meinung, für den Urlaub seien nur leicht lesbare Schmöker geeignet. ... In Wahrheit ist nichts enttäuschender, als in den Ferien, wenn endlich der Kopf frei geworden ist, mit Büchern umzugehen, die leichter zu durchschauen sind als die örtlichen Bustarife. ... Wir empfehlen ein Reclam-Büchlein mit der deutschen Übersetzung von Helmuth Vretska, in Gewicht und Größe zwei Tafeln Schokolade entsprechend. ... Der Leser bekommt nicht nur Einblick in die Nervosität, Rachsucht, Heimtücke der alten Griechen, die nach der Lektüre niemand mehr für ein vorbildlich klassisches Volk halten wird. Er bekommt auch einen Einblick in die politische Dynamik der Macht, die sich
Mehr anzeigen
unabhängig von Güte oder Schlechtigkeit der Beteiligten entfaltet. Jens Jessen in der "Zeit"
Helmuth Vretska, der 1966 eine Teilübersetzung im Reclam-Verlag vorlegte, wählte bei größtmöglicher Nähe zum Original einen leserfreundlichen Weg, sein früher und unerwarteter Tod verhinderte allerdings die Vollendung seines Werks. Daher übernahm es Werner Rinner im Auftrag des Reclam-Verlags, die Lücken zu schließen. Er bemühte sich mit Erfolg, die neu übersetzten Passagen (Teile des 2., 3., 4. und 5. Buches und das gesamte 8. Buch) mit der Vretska-Übersetzung in Einklang zu bringen. (...) Fazit: Die vorliegende Übersetzung ist sehr exakt, stilistisch ansprechend und trotzdem klar und zeitgemäß genug, um auch dem interessierten Laien einen Zugang zu Thukydides zu eröffnen. IANUS - Informationen zum Altsprachlichen Unterricht
Helmuth Vretska, der 1966 eine Teilübersetzung im Reclam-Verlag vorlegte, wählte bei größtmöglicher Nähe zum Original einen leserfreundlichen Weg, sein früher und unerwarteter Tod verhinderte allerdings die Vollendung seines Werks. Daher übernahm es Werner Rinner im Auftrag des Reclam-Verlags, die Lücken zu schließen. Er bemühte sich mit Erfolg, die neu übersetzten Passagen (Teile des 2., 3., 4. und 5. Buches und das gesamte 8. Buch) mit der Vretska-Übersetzung in Einklang zu bringen. (...) Fazit: Die vorliegende Übersetzung ist sehr exakt, stilistisch ansprechend und trotzdem klar und zeitgemäß genug, um auch dem interessierten Laien einen Zugang zu Thukydides zu eröffnen. IANUS - Informationen zum Altsprachlichen Unterricht
Schließen
»Ein unerschöpfliches Buch: zum Fürchten, zum Staunen, zum Lernen.« DIE ZEIT, 05.08.2021
"Zu den unvergänglichen Vorurteilen zeitgenössischer Lebenspraxis gehört die Meinung, für den Urlaub seien nur leicht lesbare Schmöker geeignet. ... In Wahrheit ist nichts enttäuschender, als in den Ferien, wenn endlich der Kopf frei geworden ist, mit Büchern umzugehen, die leichter zu durchschauen sind als die örtlichen Bustarife. ... Wir empfehlen ein Reclam-Büchlein mit der deutschen Übersetzung von Helmuth Vretska, in Gewicht und Größe zwei Tafeln Schokolade entsprechend. ... Der Leser bekommt nicht nur Einblick in die Nervosität, Rachsucht, Heimtücke der alten Griechen, die nach der Lektüre niemand mehr für ein vorbildlich klassisches Volk halten wird. Er bekommt auch einen Einblick in die politische Dynamik der Macht, die sich
Mehr anzeigen
unabhängig von Güte oder Schlechtigkeit der Beteiligten entfaltet." -- Jens Jessen in der 'Zeit' "Helmuth Vretska, der 1966 eine Teilübersetzung im Reclam-Verlag vorlegte, wählte bei größtmöglicher Nähe zum Original einen leserfreundlichen Weg, sein früher und unerwarteter Tod verhinderte allerdings die Vollendung seines Werks. Daher übernahm es Werner Rinner im Auftrag des Reclam-Verlags, die Lücken zu schließen. Er bemühte sich mit Erfolg, die neu übersetzten Passagen (Teile des 2., 3., 4. und 5. Buches und das gesamte 8. Buch) mit der Vretska-Übersetzung in Einklang zu bringen. (...) Fazit: Die vorliegende Übersetzung ist sehr exakt, stilistisch ansprechend und trotzdem klar und zeitgemäß genug, um auch dem interessierten Laien einen Zugang zu Thukydides zu eröffnen." -- IANUS - Informationen zum Altsprachlichen Unterricht
Schließen
Thukydides ist als antiker Historiker eine Einzelgestalt. Seine geradezu moderne Beschreibung des peloponnesischen Kriegs sucht seinesgleichen in der Antike. Seine Werk ist spannend zu lesen, besticht durch eine ausgewogene Beurteilung der Vorgänge und durchweg hat der Leser das Gefühl, …
Mehr
Thukydides ist als antiker Historiker eine Einzelgestalt. Seine geradezu moderne Beschreibung des peloponnesischen Kriegs sucht seinesgleichen in der Antike. Seine Werk ist spannend zu lesen, besticht durch eine ausgewogene Beurteilung der Vorgänge und durchweg hat der Leser das Gefühl, dass er eine Beschreibung sine ira et studio des antiken Weltkriegs vor sich hat, trotz der Tatsache, dass Thukydides auf der athenischen Seite selbst mitkämpfte. Thukydides ist der Beweis, dass auch in der Antike rational humanes Denken möglich war. Unbedingt lesenswert! CT
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für