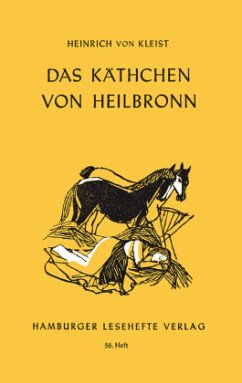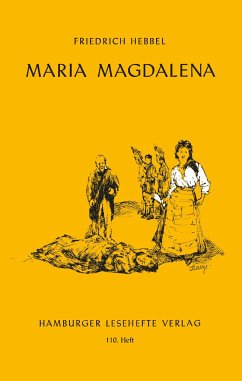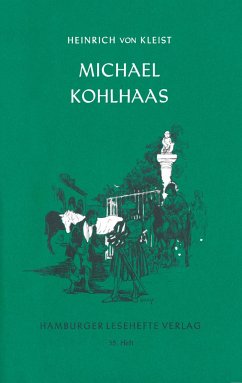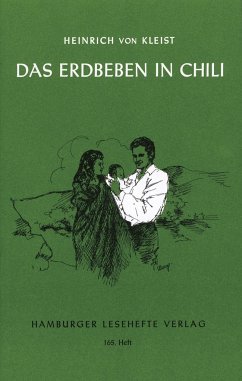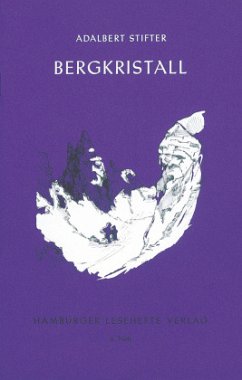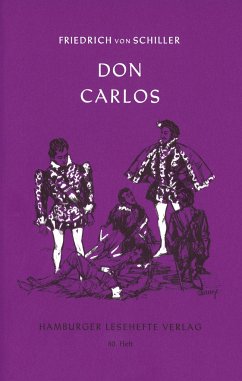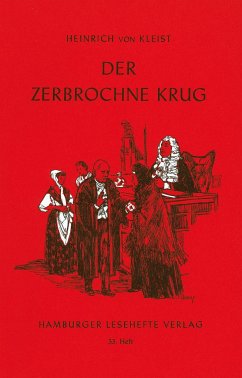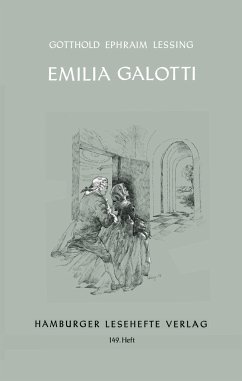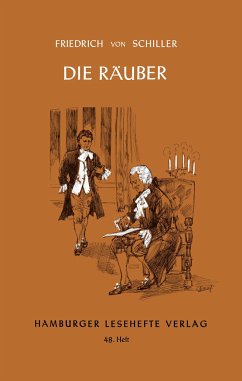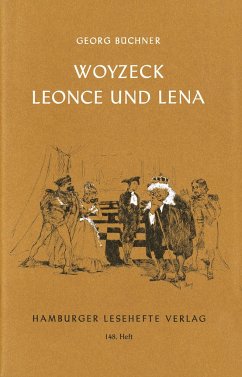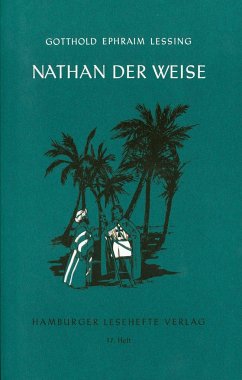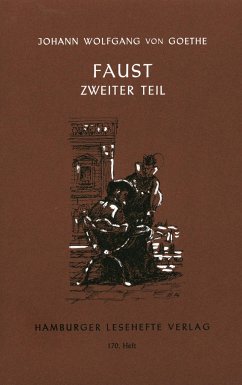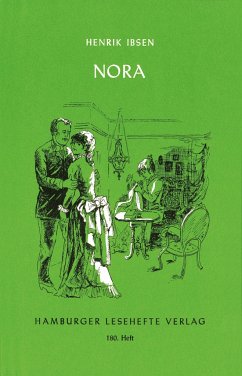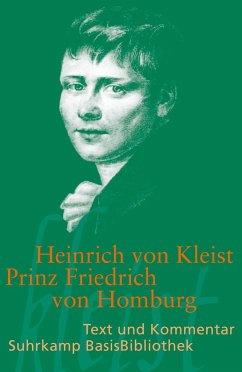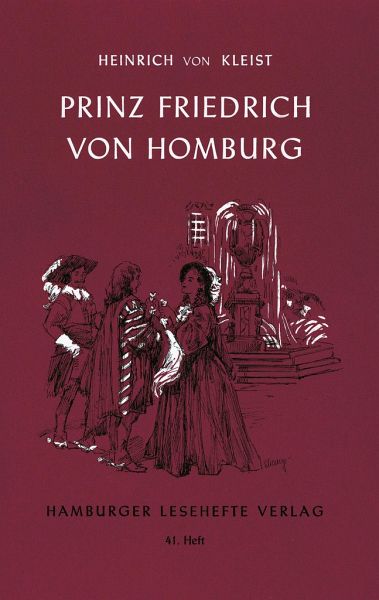
Prinz Friedrich von Homburg
Ein Schauspiel
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
2,30 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Den Stoff zu diesem Schauspiel fand Kleist in den "Brandenburgischen Denkwürdigkeiten", einer Schrift Friedrichs des Grossen. Er gestaltete die Legende von dem Opfertod Frobens, dem Ungehorsam des Prinzen von Homburg und seiner Versöhnung mit dem Grossen Kurfürsten zu dem "Prinz Friedrich von Homburg", einem politisch-historischen Schauspiel, das jedoch romantische Züge trägt, um.Der Prinz von Homburg hat durch eigenmächtiges Handeln in der Schlacht bei Fehrbellin die Vernichtung der Schweden verhindert, woraufhin er zum Tode verurteilt wird. Nach seinem Flehen um Gnade legt der Kurfürs...
Den Stoff zu diesem Schauspiel fand Kleist in den "Brandenburgischen Denkwürdigkeiten", einer Schrift Friedrichs des Grossen. Er gestaltete die Legende von dem Opfertod Frobens, dem Ungehorsam des Prinzen von Homburg und seiner Versöhnung mit dem Grossen Kurfürsten zu dem "Prinz Friedrich von Homburg", einem politisch-historischen Schauspiel, das jedoch romantische Züge trägt, um.Der Prinz von Homburg hat durch eigenmächtiges Handeln in der Schlacht bei Fehrbellin die Vernichtung der Schweden verhindert, woraufhin er zum Tode verurteilt wird. Nach seinem Flehen um Gnade legt der Kurfürst die Entscheidung über die Rechtmässigkeit des Urteils in des Prinzens eigene Hand und dieser erkennt das Urteil an. So kann der Kurfürft ihn begnadigen. Nach Hebbel "wird durch die blossen Schauer des Todes, durch seinen hereindunkelnden Schatten erreicht, was in allen übrigen Tragödien. nur durch den Tod selbst erreicht wird".Neben einem Nachwort wird auf "Geschichte, und Legende" eingegangen und ein Porträt des Prinz Friedrich von Hessen-Homburg aus Fontanes "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" gegeben. Ausführliche Anmerkungen erleichtern das Verständnis der Dichtung.