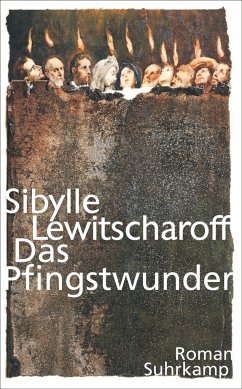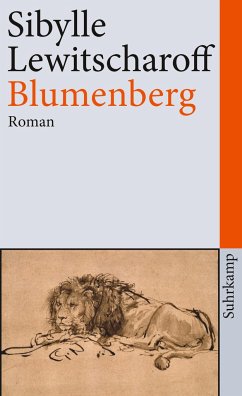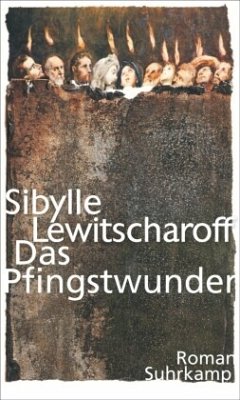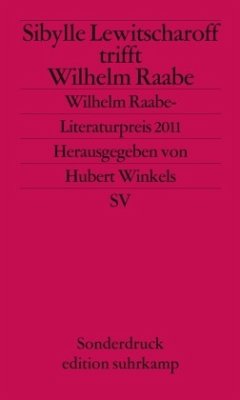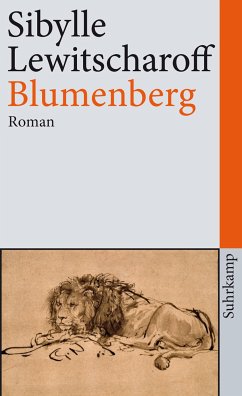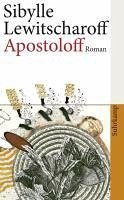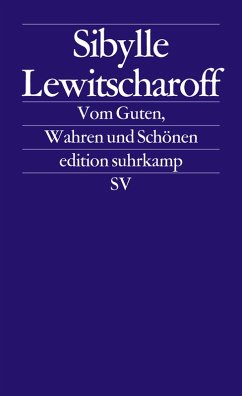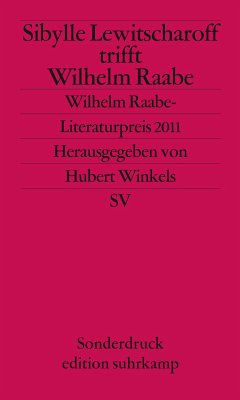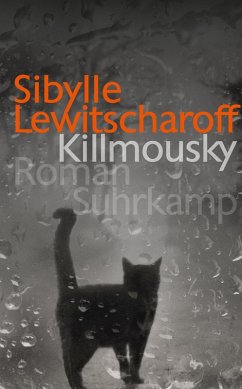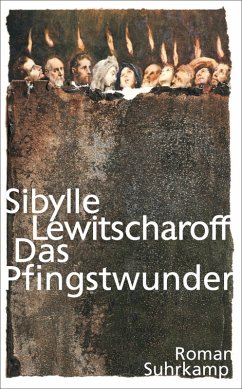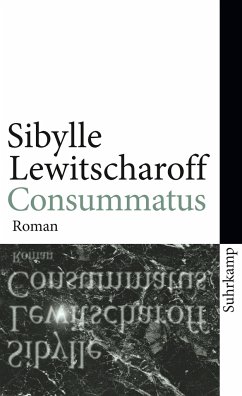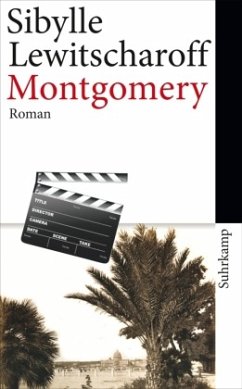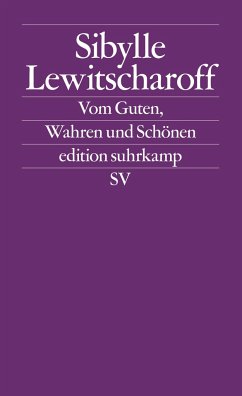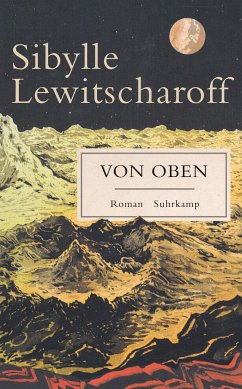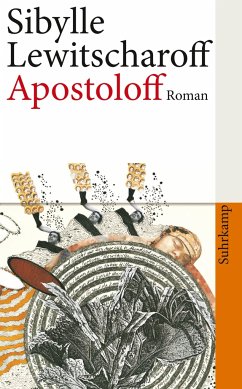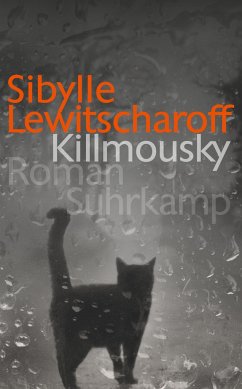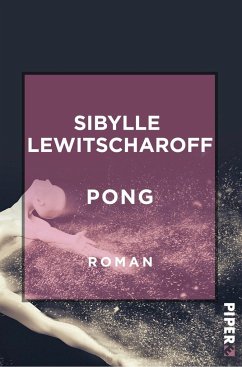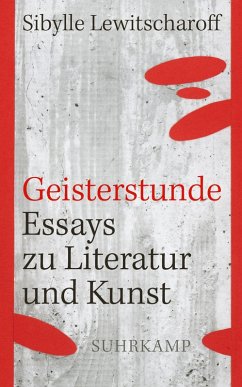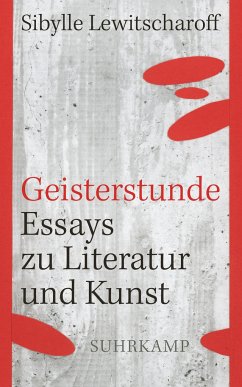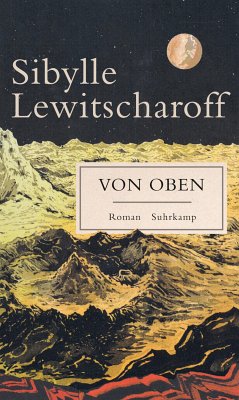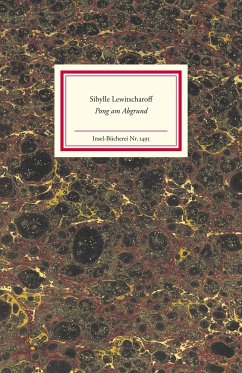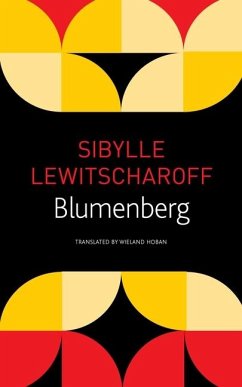Sibylle, Lewitscharoff
Lewitscharoff, SibylleSibylle Lewitscharoff wurde 1954 in Stuttgart geboren und lebt in Berlin. Sie ist eine der profiliertesten deutschsprachigen Autorinnen der Gegenwart und wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. 1998 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis, 2009 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse, 2011 mit dem Kleist-Preis und dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis sowie 2013 mit dem Büchner-Preis.
Kundenbewertungen
Verwirrung in der Gelehrtenstube
Literatur und Philosophie existieren ja nicht selten in symbiotischer Form, meist in Person eines geistigen Schöpfers, als Dichter und Denker bezeichnet, der alle beiden Kulturgattungen bedient, Nietzsche sei als Beispiel genannt. Eng verbunden sind diese Disziplinen aber auch dadur...
Verwirrung in der Gelehrtenstube
Literatur und Philosophie existieren ja nicht selten in symbiotischer Form, meist in Person eines geistigen Schöpfers, als Dichter und Denker bezeichnet, der alle beiden Kulturgattungen bedient, Nietzsche sei als Beispiel genannt. Eng verbunden sind diese Disziplinen aber auch dadurch, dass alle Denkergebnisse irgendwie fixiert werden müssen, sollen sie für die Nachwelt erhalten bleiben, und damit werden sie zwangsläufig zu Literatur. Im vorliegenden Roman bildet die philosophische Wissenschaft den reizvollen Hintergrund für eine raffiniert aufgebaute, komplexe Geschichte, die schon durch ihren Titel als Hommage an den Professor gleichen Namens gedeutet werden darf.
Die Autorin bindet einen Löwen in ihre Handlung ein, den der Gelehrte zunächst als Hirngespinst oder Studentenulk ansieht, der sich in seiner Symbolträchtigkeit jedoch immer mehr als Trostspender und gedanklicher Ruhepol erweist. Mit viel Komik und gekonntem Sprachwitz wird munter fabuliert in diesem ungewöhnlichen Roman mit seinem gewagten Titel, der ja suggeriert, hier stehe der gleichnamige Philosoph und sein Denksystem im Mittelpunkt, was manche Leser mutlos machen könnte. Keine Sorge! Äußerst elegant und schwungvoll führt Lewitscharoff durch ihre originelle Geschichte, und auch wenn man, wie ich, nicht jeden Hintersinn, jede Andeutung versteht als blutiger Laie in Sachen Philosophie, liest man dieses Buch gleichwohl mit geistigem Gewinn, vom geradezu königlichen Lesespaß ganz abgesehen.
Im Milieu professoraler Gelehrsamkeit erleben wir Blumenberg in seinem Arbeitszimmer und in der Vorlesung, einer, der fleißig seine Wissenschaft betreibt und hohe Anerkennung genießt bei seinen ehrfürchtigen, von ihm aber kaum wahrgenommenen Studenten. Vier von ihnen, ergänzt um eine wundersame Nonne, sind die anderen Protagonisten, die ihn in einer Collage von kunstvoll verschachtelten Geschichten umkreisen. Alle Figuren sind liebevoll und eindringlich beschrieben, sie stehen dem Leser beinahe plastisch gegenüber, sind greifbar nahe in dieser zweiten Erzählebene. Ergänzend sind zwei köstliche Kapitel eingeschoben, in denen der Erzähler auf sehr unterhaltsame Weise über Inhalte und Konstruktion seines Textes nachdenkt. «Ob der Erzähler wirklich wissen kann, was einem Selbstmörder zuletzt in den Sinn kommt, ist fraglich» heißt es da. Das Buchstabenleben des Romans und seine Gedankenwelt wird hier verschmitzt hinterfragt. Aber dass man einen Selbstmord so absolut unpathetisch schildern kann hat mir denn doch den Atem verschlagen.
Nach dem Tode aller Protagonisten treffen sie im Jenseits wieder zusammen, auch der Löwe ist zur Stelle. Mit ihrem rätselhaften Bericht aus einer Höhle (wem dämmert da was?) eröffnet die Autorin reichlich Raum für Interpretationen, mit denen man noch beschäftigt ist, lange nachdem man das Buch zu Ende gelesen hat. Was dem Atheisten Blumenberg und den anderen Figuren widerfährt, das langsame Verlöschen ihrer Existenzen, deutet für mich jedenfalls darauf hin, dass dieser Ort eine Vorstufe zum Nirwana ist, Himmel und Hölle existieren ja nicht. Dieses Buch ist ein meisterhaft geschriebener, wunderbar geistreicher Roman, der im wahrsten Sinne des Wortes bereichernd ist, ein selten zu findendes, intellektuell anspruchsvolles Lesevergnügen obendrein.
6 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Herrgottzack
Dantes Hauptwerk «La divina commedia» liefert im Wesentlichen den Stoff für den neuen Roman «Das Pfingstwunder» von Sibylle Lewitscharoff. Die Büchner-Preisträgerin lässt deutlich Ihre Vorliebe für anspruchsvolle Sujets erkennen, die sie im Stil des magischen Realismus in Prosa umsetzt, geschri...
Herrgottzack
Dantes Hauptwerk «La divina commedia» liefert im Wesentlichen den Stoff für den neuen Roman «Das Pfingstwunder» von Sibylle Lewitscharoff. Die Büchner-Preisträgerin lässt deutlich Ihre Vorliebe für anspruchsvolle Sujets erkennen, die sie im Stil des magischen Realismus in Prosa umsetzt, geschrieben in einer mit kreativen Wortbildungen überreich ausgeschmückten, angenehm zu lesenden Sprache. Urheber der gewaltigen Bilderflut, die sie damit beim Leser erzeugt, ist zum großen Teil Dante Alighieri, dessen «Göttliche Komödie» in über fünfzig deutschen Übersetzungen erschienen ist und hinter der Bibel weltweit den Platz zwei der meistverbreiteten literarischen Werke einnimmt. Ein Jahrtausendwerk, das hier derart umfangreich zitiert und kommentiert, erklärt und gedeutet wird, dass man fast schon von einem episch ergänzten populär-wissenschaftlichen Buch sprechen könnte. Und genau darin liegt, wie ich meine, auch dessen eigentlicher Wert, denn Hand aufs Herz: Welcher heutige Romanleser hat Dante denn wirklich gelesen?
Äußerer Rahmen der Handlung ist ein internationaler Kongress von Danteforschern, der in einem prächtigen Saal des Malteserordens auf dem Aventin in Rom stattfindet. Dort haben sich vierunddreißig Wissenschaftler aus der ganzen Welt zu ihrem jährlichen Treffen versammelt, um sich an den drei Tagen vor Pfingstsonntag 2013 in Vorträgen und Diskussionen über die «Commedia» auszutauschen. Ich-Erzähler in diesem Roman ist der deutsche Tagungsteilnehmer Gottlieb Elsheimer, zweiundsechzig Jahre alt, Professor für Romanistik in Frankfurt, der es nach eigenem Bekunden «als Dante-Gelehrter zu einigem Ansehen gebracht hat, allerdings in einer sehr überschaubaren Gemeinde». Seine «ziemlich abgebrüht» scheinende Selbstsicherheit jedoch hat arg gelitten seit diesem Kongress: «Was vor wenigen Tagen in Rom geschah, hat jedoch alles über den Haufen geworfen».
Als nämlich gegen Ende der Tagung mit vielen exzellenten Vorträgen, die auch Elsheimer als bereichernd empfand, die Glocken des Vatikans Pfingsten einläuten, geraten die Teilnehmer in eine unerklärliche Euphorie, sprechen plötzlich in vielen Muttersprachen wild durcheinander und verstehen einander trotzdem. In der Apostelgeschichte des Neuen Testaments wird berichtet, dass mit der Ausgießung des Heiligen Geistes durch Jesus die versammelten Jünger auf einmal in fremden Sprachen reden konnten, ein Wunder war geschehen, wichtige Voraussetzung für ihre christliche Mission. Auf dem Aventin war ebenfalls eine Art Pfingstwunder geschehen, nur dass hier die Teilnehmer, berauscht von Dantes Visionen, schließlich auch noch ekstatisch auf die Fensterbretter steigen, hinaushüpfen und den Gesetzen der Schwerkraft trotzend auf Nimmerwiedersehen ins Jenseits entschweben. Als einziger nicht diesem orgiastischen Rausch Erlegener bleibt Elsheimer zurück, er grübelt fortan, was ausgerechnet ihn denn ausgeschlossen habe.
Die Autorin ist als studierte Religionswissenschaftlerin bei diesem Stoff fürwahr in ihrem Element, ergeht sich in vielen klugen Reflexionen über die aus heutiger Sicht naive Darstellung Dantes, seine rigorosen, spätmittelalterlichen Vorstellungen. Die vielen historischen Figuren, denen Dante unter Führung Vergils im Jenseits begegnet, werden in Elsheimers Erzählung ergänzt um neuzeitliche Sünder von Stauffenberg bis Snowden, die Dantes rigider Klassifizierung der Sünder keinesfalls unterworfen werden dürften. Ob der Leser dieses Buch nun als Einführung in das berühmteste Werk Dantes auffasst oder es als ironisch erzählte Gelehrtensatire liest, sprachlich kommt er wie schon erwähnt voll auf seine Kosten. Das tröstet dann auch über einige Längen hinweg, die den Lesegenuss früher oder später zu schmälern beginnen, weil die danteverliebte Autorin sich unentwegt gar zu ausführlich in den Strukturen mittelalterlicher Jenseitsvorstellungen verliert. Im Roman ruft sich Elsheimer aus gleichartigen Abschweifungen meist auf gut schwäbisch zurück: «Herrgottzack!»
1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Sibylle Lewitscharoff ist nicht irgendwer, sondern eine der angesehensten deutschen Autorinnen. Am Sonntag hat die aktuelle Büchner-Preisträgerin im Staatsschauspiel Dresden gesprochen. Im Rahmen der traditionsreichen Reihe der "Dresdner Reden". Nicht irgendwer, nicht irgendwo.
Als Thema hatte sie sich "Die wissen...
Sibylle Lewitscharoff ist nicht irgendwer, sondern eine der angesehensten deutschen Autorinnen. Am Sonntag hat die aktuelle Büchner-Preisträgerin im Staatsschauspiel Dresden gesprochen. Im Rahmen der traditionsreichen Reihe der "Dresdner Reden". Nicht irgendwer, nicht irgendwo.
Als Thema hatte sie sich "Die wissenschaftliche Bestimmung über Geburt und Tod" ausgewählt, überschrieben mit dem Titel "Von der Machbarkeit". Stattdessen hielt die Autorin einen wirren Vortrag, in dem sie die Praxis der künstlichen Befruchtung „absolut widerwärtig nannte, lesbische Paare mit Kinderwunsch "grotesk", ein Kind von einer Leihmutter austragen zu lassen "grauenerregend" - und Kinder, die auf einem der genannten Wege entstanden sind, als "Halbwesen", als "zweifelhafte Geschöpfe" herabwürdigte. Platz für einen Nazi-Vergleich war auch noch.
Hätte ich am Sonntag im Staatsschauspiel gesessen, ich hätte meine Wut kaum im Zaum halten können. Angeblich blieb es ruhig. Vielleicht hat ja das Publikum vor Ort dasselbe empfunden wie ich bei der ruhigen Lektüre des Manuskripts. Nämlich, dass es sich hier weniger um eine christofaschistische Kampfrede handelt, als um ein Dokument geistiger Zerrüttung. Nun sollen ja Wahnsinnige schöne Gedichte geschrieben haben. Sibylle Lewitscharoff mag ihre vielen Literaturpreise also völlig zu Recht erhalten haben.
Aber selbst wenn sich Lewitscharoff im Nachhinein entschuldigt: Diese Rede war keine literarische Stilübung. Sondern eine gezielte, öffentliche - nicht irgendwo, nicht von irgendwem - Diffamierung von Menschen, die ihr ästhetisch nicht ins Weltbild passen. "Meine Abscheu ist in solchen Fällen größer als meine Vernunft", rechtfertigt sie die ungeheuerlichen Sätze, mit denen sie Kinder zu unwertem Leben erklärt. Das Reich, in dem ihr Abscheu Gesetz ist, liegt wohl weit außerhalb dieser Gesellschaft. Es ist ihre Privat-Hölle.
0 von 2 finden diese Rezension hilfreich