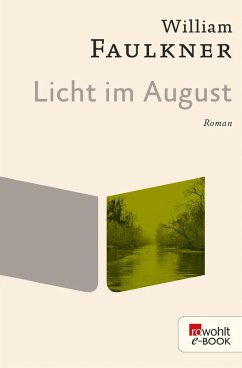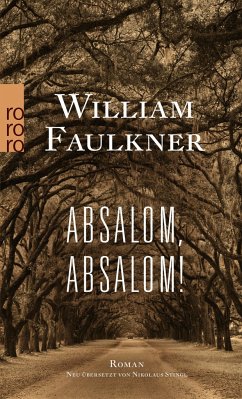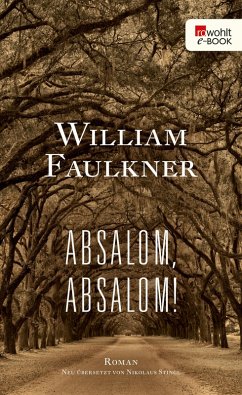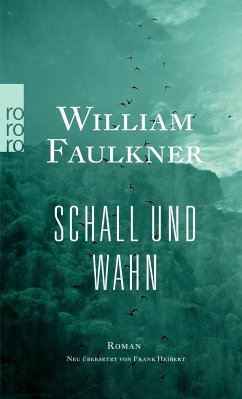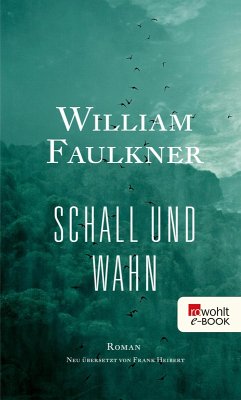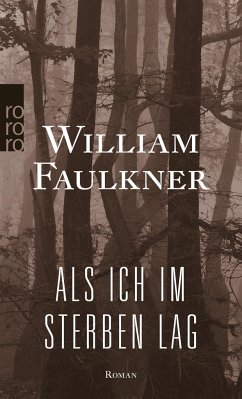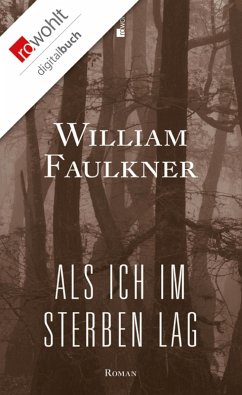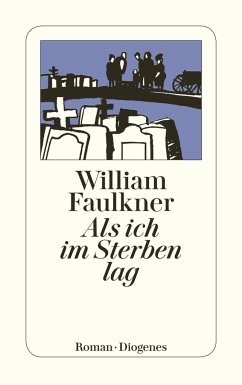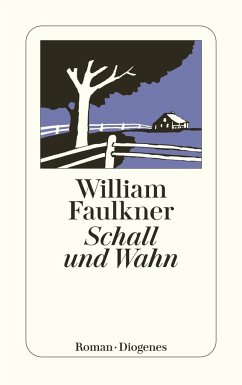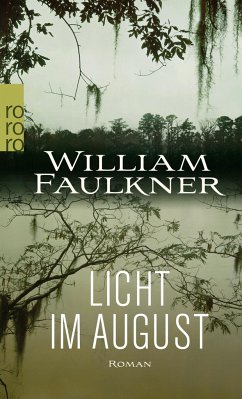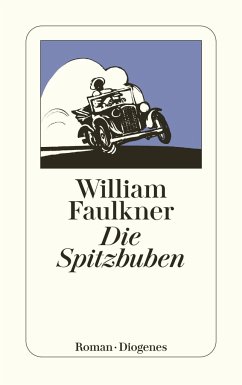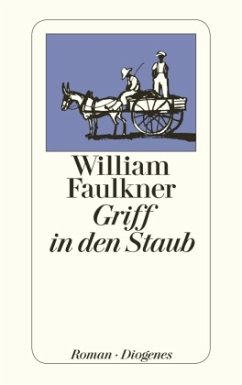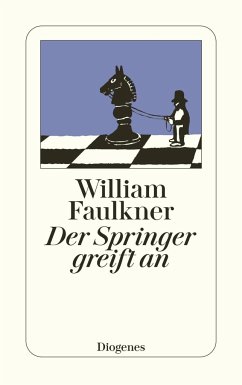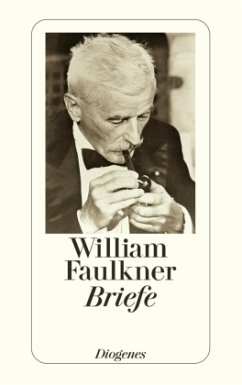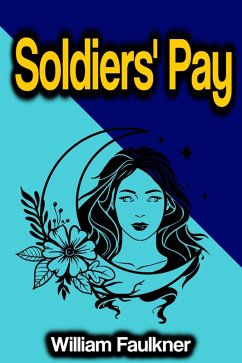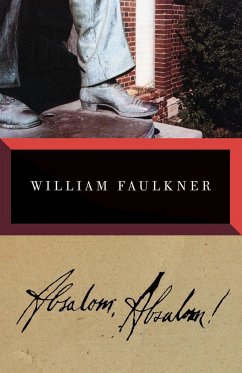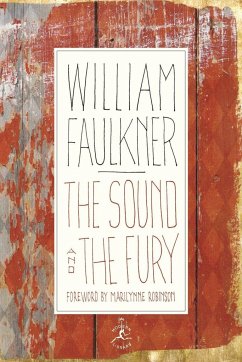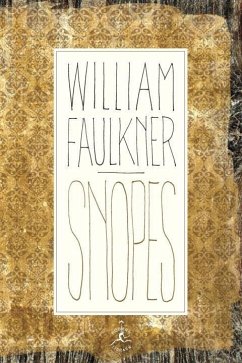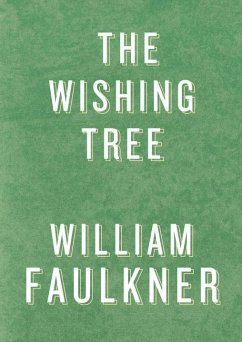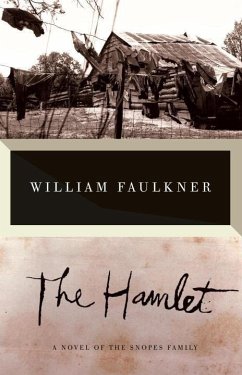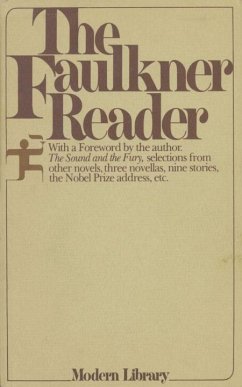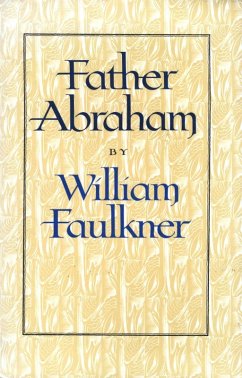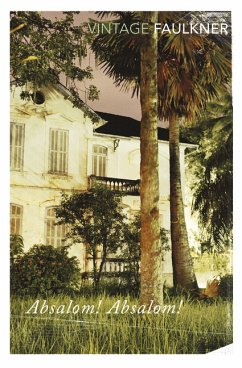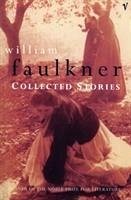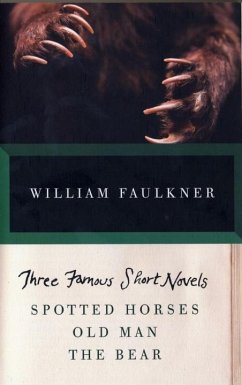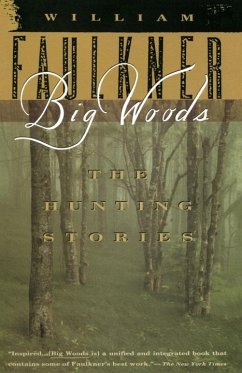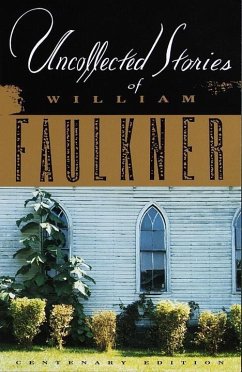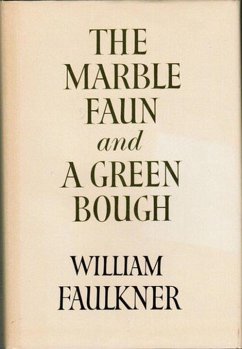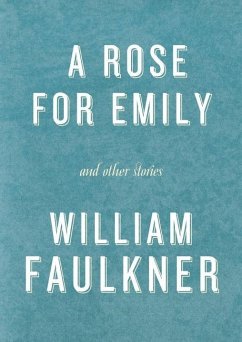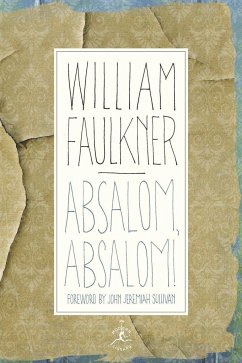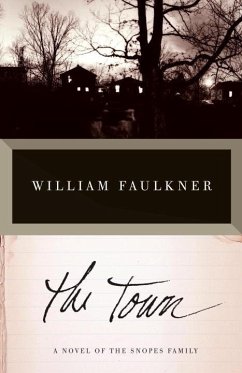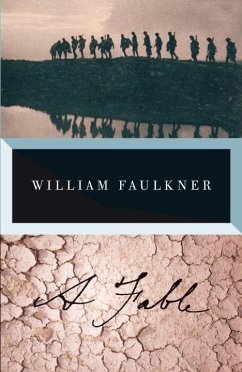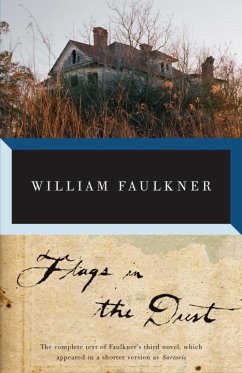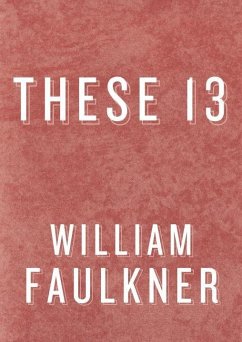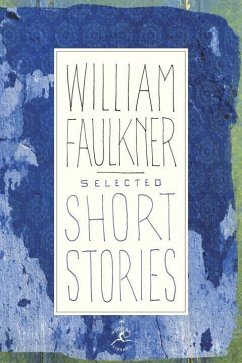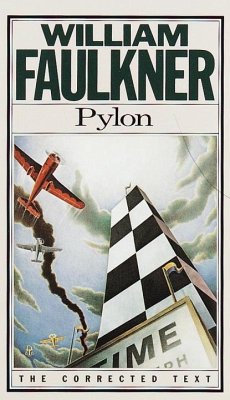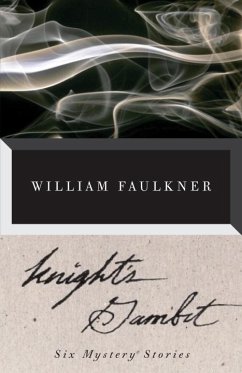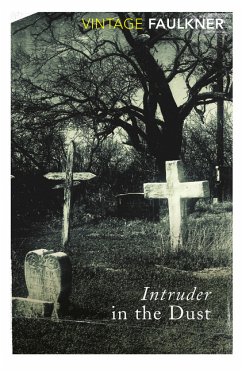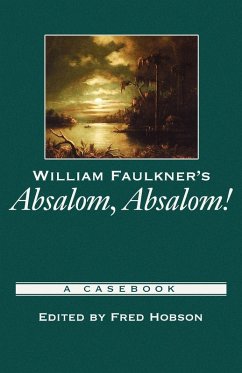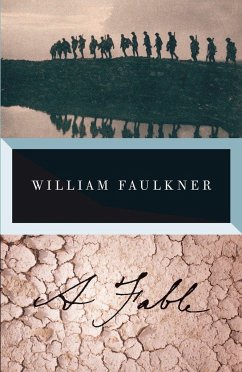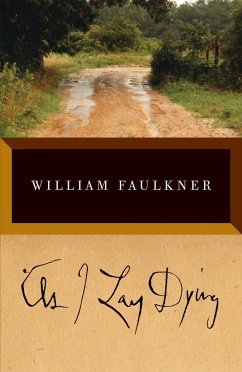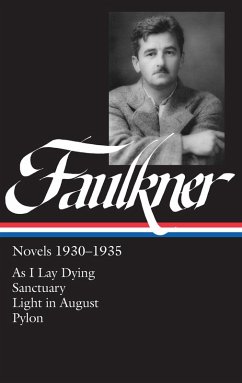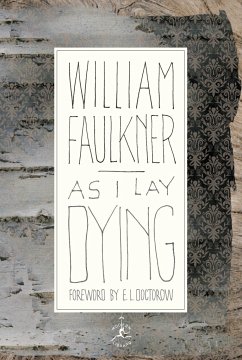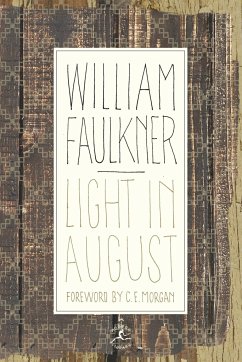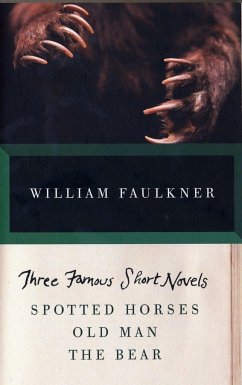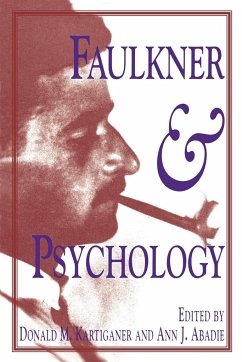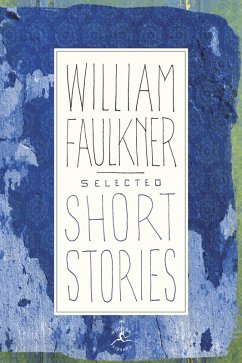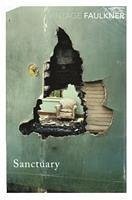William Faulkner
Dem Dichter William Faulkner (* New Albany 1897, † Oxford/USA 1962) wurde 1950 rückwirkend der Nobelpreis für Literatur 1949 zuerkannt und verliehen. Der amerikanische Autor der Moderne mit Vorliebe für ländliches und kleinstädtisches Leben, das er in einem fiktiven Yoknapatawpha County entstehen ließ, verdiente seinen Lebensunterhalt auch als Drehbuchautor in Hollywood oder als Autor von Kurzgeschichten, die er an Magazine verkaufte. Bekannt wurde William Faulkner u. a. durch "Schall und Wahn" (1929), "Die Freistatt" (1931) oder "Licht im August" (1935). Faulkner trat als Südstaatler für die Gleichberechtigung der Rassen ein und arbeitete mit dem Thema auch als Schriftsteller, u. a. in den Werken "Absalom, Absalom!" (1936) oder "Griff in den Staub" (1948), das auch verfilmt wurde. William Faulkner starb an den Folgen eines Reitunfalles.
Kundenbewertungen
Erzählkunst auf allerhöchstem Niveau
Von den Werken des Nobelpreisträgers William Faulkners gilt «Licht im August» als der in Deutschland meistgelesene Roman, er hat ihn 1931/32 in nur wenigen Monaten geschrieben. Etwa zur selben Zeit ereignet sich auch dessen Handlung, Ort des Geschehens ist die Kleinstadt Jef...
Erzählkunst auf allerhöchstem Niveau
Von den Werken des Nobelpreisträgers William Faulkners gilt «Licht im August» als der in Deutschland meistgelesene Roman, er hat ihn 1931/32 in nur wenigen Monaten geschrieben. Etwa zur selben Zeit ereignet sich auch dessen Handlung, Ort des Geschehens ist die Kleinstadt Jefferson des Bundesstaates Mississippi in den USA. Ein Südstaaten-Roman mithin, dessen spezielle Problematik bei den meisten Romanen dieses dort geborenen Autors den erzählerischen Hintergrund bildet und auch die Thematik des Plots mit beeinflusst.
Der Handlungsrahmen des in 21 Kapitel aufgeteilten schwermütigen Romans ist die im Wesentlichen im ersten und letzten Kapitel erzählte Geschichte von Lena Grove. Sie dauert nur wenige Tage im August, einer Zeit, die dem Roman seinen Titel gab und von der Faulkner schreibt: «Das Licht ist anders als sonst, es hat auf einmal eine seltsam leuchtende Eigenschaft». Lena ist von dem Taugenichts Lucas Burch geschwängert und sitzengelassen worden, kurz vor ihrer Niederkunft macht sie sich naiv zuversichtlich auf die Suche nach ihm, findet ihn schließlich und muss erleben, wie er sich wieder aus dem Staube macht. Von diesem Rahmen ausgehend schildert Faulkner in vielen Rückblenden die Vorgeschichten seiner diversen, von ihm nach und nach eingeführten Protagonisten, deren gemeinsames Merkmal entweder Schrulligkeit oder Stumpfsinn ist, der sich bei einigen aber auch als eine deutlich ausgeprägte geistige Verwirrung zeigt. Diese einzelnen Geschichten sind unglaublich kunstvoll ineinander verschachtelt, bauen aufeinander auf, ergänzen sich schrittweise in ihren Zusammenhängen und lösen sich erst nach vielen eingeschobenen Begebenheiten in einen vollständig erzählten Handlungsstrang auf.
Im Zentrum steht dabei die Geschichte des Findelkindes Joe Christmas - sie macht allein gut die Hälfte des Romans aus - der zum Mörder wird und am Ende einem Lynchmob zum Opfer fällt. Sein Kumpan ist jener Taugenichts Lucas Burch, mit dem zusammen er, der Prohibition zum Trotz, Whiskey verkauft. Der gutmütige Byron Bunch hat sich in Lena verliebt, er hilft ihr aber trotzdem, den liederlichen Kindsvater zu finden. Bei Gail Hightower, einem ehemaliger Pastor, dessen Frau unter dubiosen Umständen ihr Leben verlor und der völlig zurückgezogen lebt, sucht Byron immer wieder Rat. Auch das Mordopfer Joanna Burden, die mit Joe ein Verhältnis hat, lebt einsam in ihrem Haus, sie berät Farbige und hilft ihnen, womit sie sich aus ihrer Gemeinde ausgrenzt, für die «Nigger» trotz verlorenem Sezessionskrieg und Abschaffung der Sklaverei immer noch Menschen zweiter Klasse sind. Gegen Ende des Romans tauchen dann die Großeltern von Joe auf, es klärt sich nun, wie es dazu kam, dass er Weihnachten vor dem Waisenhaus ausgesetzt wurde, um dann mit fünf Jahren zu einem unglaublich bigotten anglikanischen Ziehvater zu kommen, dessen brutale Methoden bei der Erziehung einiges erklären in seinem späteren Verhalten.
Faulkner erzählt seine komplexe, schwermütige Geschichte in einer unglaublich dichten, kompakten Sprache, die vom Leser stets volle Aufmerksamkeit fordert. Sehr häufig setzt er dabei virtuos Bewusstseinsstrom und inneren Monolog ein, nicht selten sogar kombiniert im gleichen Satz. Seine außergewöhnliche Sprachkunst vermag mit wenigen Worten so immens viel zu transportieren, dass man geneigt ist, nach einigen Seiten eine Lesepause einzulegen, um das Gesagte zu verarbeiten, die solcherart entstandenen Bilder auf sich wirken zu lassen, die Geschehnisse gebührend einzuordnen und zu bewerten. Andererseits wird trotz der ungewöhnlich ruhigen, ebenso gemächlichen wie suggestiven Erzählweise Faulkners beim Leser eine Spannung erzeugt, die ihn immer weiter in die Geschichte hineinzieht und dann nicht mehr ruhen lässt, bis er die letzte Seite erreicht hat. Das ist Erzählkunst auf allerhöchstem Niveau.
„Als ich im Sterben lag“ ist der wohl ungewöhnlichste, aber auch einer der wichtigsten Romane William Faulkners (1897-1962). Der Nobelpreisträger selbst bezeichnete diesen 1930 erschienenen Roman als seinen besten. Und wahrlich, diese nicht einmal 200 Seiten stecken voller Lebensweisheiten und psychologischer Stu...
„Als ich im Sterben lag“ ist der wohl ungewöhnlichste, aber auch einer der wichtigsten Romane William Faulkners (1897-1962). Der Nobelpreisträger selbst bezeichnete diesen 1930 erschienenen Roman als seinen besten. Und wahrlich, diese nicht einmal 200 Seiten stecken voller Lebensweisheiten und psychologischer Studien, dass man nicht an das literarische Werk eines 33jährigen glauben möchte.
Erzählt wird der ereignisreiche und wochenlange Leichenzug einer armen weißen Farmersfamilie, jedoch nicht in einem fortlaufenden Prosatext, sondern in ca. sechzig kurzen Abschnitten, meist inneren Monologen der Beteiligten oder der zufällig diesem merkwürdigen Zug begegneten Personen.
Addie Bundren, die Matriarchin der Farmersfamilie, liegt im Sterben. Noch auf dem Totenbett nimmt sie ihrem Mann Anse das Versprechen ab, sie in ihrem Heimatort Jefferson beizusetzen, wo ihre Sippe heute immer noch lebt. Erst vier Tage nach Addies Tod bricht die Familie mit dem Sarg auf, dabei hegt jedes Mitglied eigene Interessen. Der zahnlose Familienvater Anse will die Reise z.B. dazu nutzen, um ein neues Gebiss zu bekommen; während seine Tochter Geld für eine Abtreibung auftreiben will.
Vom Sargbau über den Verkauf einer Fuhre Holz und den beginnenden Regen, der die Flüsse über die Ufer treten lässt, berichten die Familienmitglieder. Im Mittelpunkt steht natürlich der Leichenzug ins nur vierzig Meilen entfernte Jefferson, der aber zu einer beschwerlichen Reise mit einem Mauleselgespann wird.
Da berichten die drei Söhne Cash, Darl und Jewel sowie die schwangere Tochter Dewey Dell von ihren Erlebnissen in der Vergangenheit und während des bizarren Unternehmens. Hindernisse und Unglücksfälle beherrschen den makabren Leichenzug durch das fiktive Yoknapatawpha: im Mississippi-Hochwasser stürzt eine Brücke ein - dabei gehen fast Fuhrwerk und Sarg verloren -, außerdem bricht sich Cash sein bereits verkrüppeltes Bein, das man notdürftig mit Zement schient. Dennoch muss es immer weitergehen, denn irgendwie scheint der Geist der toten Addie wie ein Befehl über ihnen zu schweben. Und so lässt Faulkner selbst die Verstorbene einmal zu Wort kommen.
Der Leichenzug und die Geschichten der Bundrens bilden zwar den Hauptstrang der Romanhandlung, aber immer wieder berichten auch Personen außerhalb der Familie von ihren Begegnungen mit den Bundrens, so der Arzt, Nachbarn, Drugstore-Inhaber oder der Pastor, der wahrscheinlich früher mit Addie ein Verhältnis hatte.
Nachdem Addie begraben wurde, geht das Leben der Familie mit allem Unglück oder Glück weiter: Darl kommt ins Irrenhaus, Cash verliert vielleicht sein Bein, Anse nimmt das Geld seiner Tochter, das sie heimlich für eine Abtreibung beiseite gelegt hat. Er verschwindet damit und kommt nicht nur mit einem Gebiss sondern auch mit einer neuen Frau zurück.
Fazit: „Als ich im Sterben lag“ ist ein Höhepunkt im Schaffen William Faulkners, der sich hier als ein hervorragender Kenner des menschlichen Lebens zeigt.
Manfred Orlick
4 von 5 finden diese Rezension hilfreich
"Licht im August" (1932 erschienen) greift das immer wieder aufwühlende, erregende Problemthema der USA auf: die Rassenfrage. Damals hochaktuell und heute leider immer noch nicht ganz überwunden, schildert Faulkner anschaulich und ergreifend von den Ereignissen die die Hochschwangere Lena auf der Suche nach ihrem Gel...
"Licht im August" (1932 erschienen) greift das immer wieder aufwühlende, erregende Problemthema der USA auf: die Rassenfrage. Damals hochaktuell und heute leider immer noch nicht ganz überwunden, schildert Faulkner anschaulich und ergreifend von den Ereignissen die die Hochschwangere Lena auf der Suche nach ihrem Geliebten in der Großstadt Jefferson vorfindet. Am Rande der Stadt wird in einem brennenden Haus eine Frauenleiche entdeckt. Der 33-jähriger farbige Joe Christmas, der gleich in der Nachbarschaft wohnt, soll daran Schuld haben. Seine Lebensgeschichte und die vielen Schicksale die damit verbunden sind machen den Haupthandlungsstrang der Geschichte aus. Faulkner wechselt zwischen mehreren Erzählebenen. Ausgehend vom Moment des Verbrechens in Jefferson, taucht er teilweise über mehrere Generationen hinweg in die Vorgeschichte einzelner Protagonisten ein.
Ich bin von diesem Buch ganz begeistert, finde es rasant und spannend.
Der Roman „Schall und Wahn“ („The Sound and the Fury“), erschienen 1929, ist eines der frühen Werke des amerikanischen Schriftstellers William Faulkner (1897-1962) und dennoch gehört er zu den Klassikern der Weltliteratur des 20. Jahrhunderts. Für Faulkner war es sogar „dasjenige meiner Bücher, das ich am...
Der Roman „Schall und Wahn“ („The Sound and the Fury“), erschienen 1929, ist eines der frühen Werke des amerikanischen Schriftstellers William Faulkner (1897-1962) und dennoch gehört er zu den Klassikern der Weltliteratur des 20. Jahrhunderts. Für Faulkner war es sogar „dasjenige meiner Bücher, das ich am meisten liebe“.
Am Beispiel der Familie Compson aus Jefferson, Mississippi, erzählt der Autor vom Niedergang des alten amerikanischen Südens, das ein zentrales Thema seines gesamten Schaffens war. Hier bedient sich Faulkner allerdings eines ungewöhnlichen Erzählstils, denn das Familienschicksal wird an nur drei aufeinanderfolgenden Apriltagen des Jahres 1928 dargestellt.
Zunächst gibt Faulkner eine kurze, aber detaillierte Einführung in die bewegte Vergan-genheit der Compsons seit dem 17. Jahrhundert. Danach beginnt die eigentliche Familiengeschichte, die vielfach in inneren Monologen der Hauptfiguren dem Leser unterbreitet wird.
Am ersten Tag des Romans wird der beklemmende Alltag der Familie aus der Sicht des erwachsenen und geistig behinderten Benjamin geschildert. Daher wirken seine Betrachtungen und Sinneseindrücke zusammenhangslos und geheimnisvoll. Ergänzt werden Benjamins verworrene Gedankengänge durch die Erinnerungen eines seiner Brüder, wobei der Roman einen Zeitsprung um fast achtzehn Jahre zurück macht.
Am zweiten Apriltag, der allerdings einen Tag vor dem ersten Romanabschnitt liegt, schildert ebenfalls ein Bruder seine Sicht der Dinge, während am abschließenden dritten Tag der Erzähler selbst das Wort ergreift, ohne jedoch alle Geheimnisse der Familie Compson zu enträtseln.
„Schall und Wahn“ ist, wie die meisten Roman Faulkners, keine leichte Lektüre. Die Handlung wird zersprengt von Rückblenden, Schnitten und inneren Monologen. Trotz dieses experimentellen und innovativen Erzählstils gelingt es dem Autor immer wieder, den Leser zu fesseln und die Spannung wachzuhalten. Der Roman wurde 1959 („Fluch des Südens“) unter der Regie von Martin Ritt und mit Yul Brunner und Joanne Woodward verfilmt.
Manfred Orlick
4 von 4 finden diese Rezension hilfreich
In mehr als zwanzig Romanen und Kurzgeschichtenbänden zeichnete der amerikanische Schriftsteller und Nobelpreisträger William Faulkner (1897-1962) ein anschauliches und wirklichkeitstreues Abbild des Lebens in den Südstaaten. In ihnen beschrieb er in zahlreichen Familien- und Einzelschicksalen den Niedergang der tra...
In mehr als zwanzig Romanen und Kurzgeschichtenbänden zeichnete der amerikanische Schriftsteller und Nobelpreisträger William Faulkner (1897-1962) ein anschauliches und wirklichkeitstreues Abbild des Lebens in den Südstaaten. In ihnen beschrieb er in zahlreichen Familien- und Einzelschicksalen den Niedergang der traditionell-aristokratischen Lebensform und behandelte auch die Rassenprobleme seiner Zeit.
In seinem letzten Roman „Die Spitzbuben“ („The Reivers“), den er 1961 innerhalb weniger Wochen schrieb, behandelt er diese Themen sehr humorvoll - fast im Stil eines Mark Twain. Und so erinnert die turbulente Geschichte etwas an Tom Sawyer und Huckleberry Finn.
In dem Roman erzählt der Großvater Lucius „Loosh“ Priest von seinem jugendlichen Abenteuer. Mit zwei schrägen, aber liebenswürdigen Gestalten hatte er sich als Elfjähriger auf eine abenteuerliche Spritztour mit dem nagelneuen Auto seines Großvaters gemacht.
Lucius überredet Boon Hogganbeck, der ein mutiger, aber recht unzuverlässiger Bursche ist, ihn zu chauffieren. Außerdem komplettiert der pfiffige Farbige Ned das Ausreißer-Trio. Zunächst machen sie sich auf nach Memphis, wo sie Boons Freundin, die Prostituierte Corrie, treffen.
Inzwischen hat Ned das Auto gegen ein gestohlenes Rennpferd eingetauscht, mit dem sie an einem Rennen teilnehmen, das eher einer großen Schummelei gleicht. Außerdem haben es die drei Abenteurer mit einem fiesen Sheriff zu tun, der sie verhaftet. Doch Corrie befreit sie mit ihren Verführungskünsten, was wiederum den eifersüchtigen Boon auf die Palme bringt. Wieder daheim heiraten Boon und Corrie jedoch und wollen ihr erstes Kind nach Lucius benennen.
Im Mittelpunkt des turbulenten Romans steht die Mannwerdung des halbwüchsigen Lucius, der gleichzeitig auch die erzählende Person ist. Die famose Geschichte wurde 1969 mit Steve McQueen in der Rolle des Boon Hogganbeck verfilmt.
Manfred Orlick
2 von 3 finden diese Rezension hilfreich
Großartiges Buch – miserable Übersetzung: Maria Carlsson sind reihenweise Schnitzer unterlaufen, zudem hat sie von der alten Hess/Schünemann-Übersetzung hemmungslos abgeschrieben, mit der Folge, dass etliche der schlimmsten Pannen auch in dieser angeblichen Neuübersetzung wieder auftauchen. Fünf Beispiele:
1. ...
Großartiges Buch – miserable Übersetzung: Maria Carlsson sind reihenweise Schnitzer unterlaufen, zudem hat sie von der alten Hess/Schünemann-Übersetzung hemmungslos abgeschrieben, mit der Folge, dass etliche der schlimmsten Pannen auch in dieser angeblichen Neuübersetzung wieder auftauchen. Fünf Beispiele:
1. Gleich auf der ersten Seite des Buches ist (neue wie alte Ü.) von „grünen Reihen abgeernteter Baumwollstauden“ die Rede. Damit ist das Geschehen sogleich in die falsche Jahreszeit versetzt, denn „green rows of laidby cotton“ sind keine Felder nach, sondern vor der Baumwollernte, denn „laidby“ ist ein Feld, das bis zum endgültigen Reifen der Früchte nicht mehr bearbeitet werden muss.
2. Als der kleine Vardaman den übergroßen Fisch anschleppt, kommentiert dies der Nachbar mit einer Hyperbole. Die rhetorische Figur der Übertreibung wird von Carlsson nicht erkannt, und daher reimt sie sich einfach etwas zusammen: Aus „hog“, „Sau“, wird „Schweinsfisch“ (alte Ü.) bzw. „Katzenfisch“ (neue Ü.), und statt: „Was’n das?“, sag ich. „Ne Sau? Wo hast du die denn her?“, für: „What’s that?“ I say. „A hog? Where’d you get it?“, heißt es bei Carlsson: „Was ist das?“, frag ich. „Ein Katzenfisch? Wo hast du ihn gefangen?“
3. Als Doktor Peabody, der dem besorgten Anse versichert hat, von Zahlungsunfähigen kein Geld für Behandlungen zu verlangen, sich darüber ereifert, dass er in seinem Alter und bei seinem Übergewicht auf dem Weg zu seiner Patientin noch mühsam mit Hilfe eines Seils einen Hang hinaufbefördert werden muss, meint er bei sich: „I reckon it’s because I must reach the fifty thousand dollar mark of dead accounts on my books before I can quit.“ Carlsson kupfert die alte Übersetzung einfach ab und macht aus „dead accounts“, aus Konten ohne Umsätze, „Totenscheine“, und aus dem selbstironischen „Ich schätze, weil ich erst 50.000 Dollar Außenstände in meinen Büchern stehen haben muss, bevor ich aufhören kann“ wird bei ihr: „Wahrscheinlich weil ich mit den Totenscheinen die Fünfzigtausend Dollar Marke erreichen müsste, bevor ich aufhören kann.“
4. Besonders ärgerlich ist, dass "I want to be beholden to none", eine Wendung mit der Anse immer wieder ausdrückt, keine fremde Hilfe annehmen zu wollen, immer wieder als "ich will von niemand gesehen werden" übersetzt wird, mit dem Ergebnis, dass es bei Carlsson und ihren Vorgängern heißt, Anse wolle beim Begraben der Leiche seiner Frau nicht gesehen werden, während Anse damit nur klar machen will, warum er und seine Söhne das Loch für den Sarg selbst ausheben werden. Ein Blick ins Wörterbuch hätte Carlsson belehrt, dass "to be beholden" auch "verpflichtet sein", "dankbar sein" heißt, und hätte sie Faulkners Text verstanden, hätte sie gemerkt, dass "to be beholden" in diesem Buch immer mit "verpflichtet sein" zu übersetzen ist, da es wesentlich zur Charakterisierung von Anse dient.
5. Als Addie Bundren gestorben ist, ist ihr Sohn Vardaman völlig verwirrt von all der Aufregung schließlich so todmüde, „that [...] his face looked like one of these here Christmas masts that had done been buried a while and then dug up“. „Christmas masts“?? Wie man leicht eruieren kann, hat Faulkner selbst auf diese Frage in einem Radiointerview erklärt, dass es sich dabei um die Masken handele, die Kinder vor Halloween und Weihnachten in den Läden kaufen können, und dass man in Mississippi, wo sein Buch spielt, eben „masts“ sage statt „masks“. Carlsson schreibt von ihren Vorgängern wieder einmal ab und macht aus einem Gesicht, das aussieht wie eine Weihnachts- oder besser: Halloweenmaske, die in der Erde gelegen hat, eines, das aussieht wie Weihnachtsgänse, die in der Erde begraben waren!
Kritiker lesen Übersetzungen höchst selten wirklich gründlich und vergleichend (Ingendaay tut es offensichtlich nicht). Carlssons Updike-Übersetzungen wurden nie wirklich auf den Prüfstand gelegt, und ihr Versagen bei der Übersetzung von Nabokovs „Lolita“ ist praktisch aktenkundig.
2 von 2 finden diese Rezension hilfreich