BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 79 Bewertungen| Bewertung vom 10.04.2025 | ||
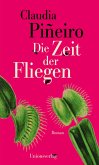
|
Weibliche Selbstjustiz. |
|
| Bewertung vom 29.03.2025 | ||
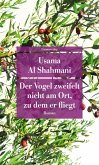
|
Der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt Dies ist der dritte Roman (eine Trilogie?) von Usama Al Shamani, der als Flüchtling aus dem Irak in die Schweiz kam und dort heimisch wurde. Heimisch in der Landschaft, in den Wäldern, an den Ufern der Flüsse und Bächen und heimisch in der deutschen Sprache. |
|
| Bewertung vom 06.03.2025 | ||

|
Anima mundi oder Der Kreislauf des Lebens 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 08.02.2025 | ||
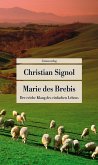
|
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 14.01.2025 | ||

|
Jeder Mensch ist eine Geschichte |
|
| Bewertung vom 09.12.2024 | ||
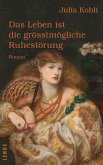
|
Das Leben ist die grösstmögliche Ruhestörung Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden |
|
| Bewertung vom 10.11.2024 | ||
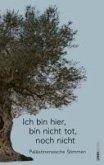
|
Ich bin hier, bin nicht tot, noch nicht Freedom is just another word for nothin’ left to lose (Janis Joplin) |
|
| Bewertung vom 28.10.2024 | ||

|
Eine Mutter ist eine Mutter ist eine Mutter? |
|
| Bewertung vom 30.09.2024 | ||
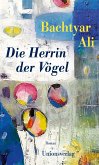
|
Die Magie eines Menschen ist größer als das gesamte Universum. |
|
| Bewertung vom 25.08.2024 | ||

|
Schießen Sie nicht auf den Tamandin. |
|
