BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 27 Bewertungen| Bewertung vom 01.04.2025 | ||
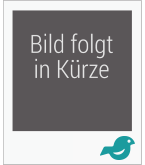
|
Ein handliches Bändchen mit knapp unter 500 Seiten und unendlich viel Material. Viel kann man, etwa bei Rheinsberg, sogar über die unmittelbare Nachkriegszeit erfahren, das Hin- und Her- der Geschichte „im“ Wedding, die Rolle des Schlosses und der Baugeschichte in Charlottenburg oder des Joachimthaler Gymnasiums in Wilmersdorf, die Geschichte von Frederswalde sind knapp und farbig gelungen. Das Bändchen verfügt über ein exzellentes Stichwortverzeichnis so ermöglicht es z. B. den Zugang zur Firmengeschichte der AEG. |
|
| Bewertung vom 07.03.2025 | ||

|
Botho Strauss‘ zeitgenössische Zaubersprüche in biblischer Größe |
|
| Bewertung vom 28.01.2025 | ||

|
Wilhelm von Bode und Marie Rimpau Man kann dieses Büchlein als eine private Geschichte des Sehen-Lernens lesen: |
|
| Bewertung vom 20.09.2024 | ||
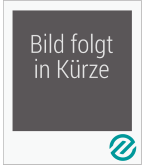
|
Das optimale Geschenk für den, der kurz erklärte Bilder über die Stuttgarter Stadtgeschichte gerne anschaut: Qualität und Auswahl der Fotos aus der Vorkriegszeit sind eindrucksvoll. |
|
| Bewertung vom 25.08.2024 | ||

|
Graf Petöfy. Unterm Birnbaum. Cecile / Romane und Erzählungen, 8 Bde. 4 Mich hat diesmal bei „Unterm Birnbaum“ auch beeindruckt, wie Kultur, von den Theaterbesuchen in Berlin bis zum Grabkreuz, die erzählte Geschichte – eigentlich nicht besonders erfreulich – beeinflusst. Ganz anders dagegen wirkt Kultur in Cécile, s. als Auszug: S. 352, Rosa:„Ich missbillige diese Kunstprüderie, die doch meistens nur Hochmut ist. Die Kunst soll die Menschen erfreuen, immer da sein, wo sie gerufen wird, aber sich nicht wie die Schnecke oder gar vornehmen im Haus zurückziehen. Die schrecklichsten sind die Klaviervirtuosen, die 12 Stunden lang spielen, wenn man sie nicht hören will, und nicht spielen, wenn man sie hören will. Das Verlangen nach einem Walzer ist die tödlichste der Beleidigung, und doch ist der Walzer etwas Hübsches und wohl eines Entgegenkommens wert. Denn er macht ein Dutzend Menschen auf eine Stunde glücklich.“ Besonders berührt hat mich, wie passend die außerhalb dem früheren sowjetischen Raum kaum bekannten Wereschagin und die beginnende Industrialisierung Zentralasiens einfließen, Tintorettos „Salat von Engelfüssen“ in der Anmerkung, S. 533 aufgeschlüsselt wird. Die entspannt-konzentrierte Distanz ist auch in den Beschreibungen spürbar, wenn es etwa heißt, das Wetter sei „zwischen nebeln und nieseln“. |
|
| Bewertung vom 09.08.2024 | ||

|
Die Präzision des Autors, dem ja auch zur "Angst des Torwarts vor dem Elfmeter" etwas einfiel, bewährt sich auch hinsichtlich dem Verhältnis zu einem (seinem?) Kind, wenn man auch Umzüge nicht, wie im Buch, als Schicksal wahrnehmen, sondern das Kindeswohl dabei berücksichtigt wissen will. Strafen werden zwar spürbar nur zurückhaltend aber doch in einer Weise besprochen, die eher Bedenken erweckt. So ist das Buch auch ein Zeugnis einer Übergangszeit. |
|
| Bewertung vom 08.08.2024 | ||
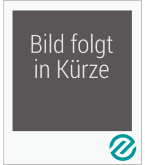
|
Vieles ist eher beliebig. Über Fontane zB erfährt man wenig, was der nicht wusste, der den Namen kannte, Uhlands politische Karriere wird rechtfertigend, aber so sehr auf die altwürttembergischen Umstände Bezug nehmen berichtet, dass Heuss’ Verständnis für Uhland kaum nachvollziehbar ist und umso mehr in Erinnerung bleibt, wie Heuss Uhland– wohl zu Recht, aber Uhlands dichterisches Werk hätte, gerade wo es – Ballade über Eberstein – eher peinlich ist doch Verständnis verdient gehabtü– gegen über Hölderlin und Mörike deklassiert. |
|
| Bewertung vom 28.07.2024 | ||
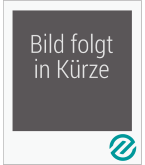
|
Populär dürfte Heuss gewesen sein, weil er dem nervösen Volk durch seine Vielseitigkeit und Unverbindlichkeit den verführerischen Eindruck vermittelt, es werde alles so gut. Dieser war wiederum eher beliebig und mag gefährlich gewesen sein. Bedeutend dürfte er deshalb gewesen sein, weil er ein Gegengewicht zu dem zunehmend alternden, erratisch werdenden Adenauer bildete. Das Gegengewicht wird nicht etwa durch eine Gegenposition, sondern |
|
| Bewertung vom 18.04.2024 | ||

|
Zu den 4 Bänden: |
|
| Bewertung vom 05.04.2024 | ||
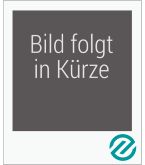
|
Ein Leben in Brennpunkten unserer Zeit Wie im Telegrammstil läuft das hochaktive Leben eines der wirtschaftspolitischen Denker der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ab, von seiner natürlich symphatisierenden, aber distanziert berichtenden, kenntnisreichen Wittwe beschrieben. Insbesondere die personelle Tragödie der Weimarer Republik wird handgreiflich, deren wichtige Führer wie Ebert, Rathenau, Stresemann, Preuß, Erzberger ermordet wurden oder früh starben, und die die, die der Allgemeinheit plausible Lösungen für die insbesondere wirtschaftspolitisch so schwierigen Fragen hätten darstellen können, wie Schacht und den besonders mitfühlend und doch hart gezeichneten Popitz, alsbald an den Nationalsozialisten verlor. |
|
