BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 102 Bewertungen| Bewertung vom 16.03.2025 | ||
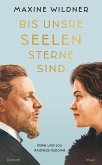
|
Bis unsre Seelen Sterne sind. Rilke und Lou Andreas-Salomé Was für eine Enttäuschung |
|
| Bewertung vom 25.02.2025 | ||
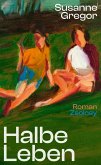
|
Zwei Leben |
|
| Bewertung vom 11.02.2025 | ||
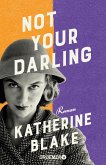
|
Als Tiger gesprungen … |
|
| Bewertung vom 21.01.2025 | ||
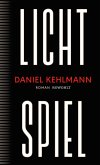
|
Reichlich dünn! |
|
| Bewertung vom 19.01.2025 | ||

|
Mittelschicht |
|
| Bewertung vom 14.01.2025 | ||
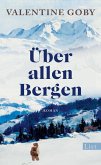
|
Vadim wird Vincent |
|
| Bewertung vom 11.11.2024 | ||
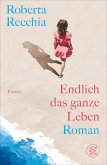
|
Kitsch as Kitsch can |
|
| Bewertung vom 08.10.2024 | ||
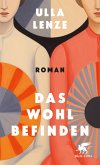
|
Verschenkte Sujets |
|
| Bewertung vom 01.10.2024 | ||
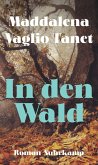
|
Vielerlei Einsamkeit |
|
| Bewertung vom 30.08.2024 | ||
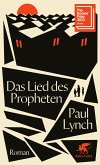
|
Abgrund |
|
