BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 117 Bewertungen| Bewertung vom 18.11.2024 | ||

|
Der Wald – schon immer war er von zentraler Bedeutung in der Literatur, voller Symbolkraft und Mystik. Mason setzt mit seinem Werk den North Woods, den nördlichen Wäldern Massachusetts, ein literarisches Denkmal, dessen Üppigkeit an Sprachstilen, Genre und Figuren in meinen Augen der immensen Vielfalt des Waldes gleichkommt. Ein Meisterwerk, das zu meinen Jahreshighlights zählt. |
|
| Bewertung vom 09.11.2024 | ||

|
Das Haus der Bücher und Schatten Eine gelungene Mischung aus Krimi und Schauergeschichte |
|
| Bewertung vom 09.11.2024 | ||

|
Lingyuans neuster Roman basiert auf dem abscheulichen Mord an der der chinesischen Studentin Li Yangjie 2016 in Dessau. Und gerade deshalb möchte ich darauf hinweisen, dass es sehr explizite Szenen von Kindesmisshandlung, psychischer, physischer und sexueller Gewalt gibt. Aber der Reihe nach. |
|
| Bewertung vom 29.10.2024 | ||

|
Die junge, unbedarfte Journalistin Michelle will ihrem Kollegen Hamza nicht glauben, als dieser ihr sagt, er sei einer rechtsradikalen Zelle in der Hamburger Polizei auf der Spur. Wenig später wird er angeschossen und Michelle, die eigentlich an ihrem Traumprojekt – ein Buch über einflussreiche Frauen in Deutschland – arbeitet, beginnt auf eigene Faust zu ermitteln und stößt auf ein weit verzweigtes Netz aus Korruption, Rechtsextremismus und Kriminalität. |
|
| Bewertung vom 21.10.2024 | ||
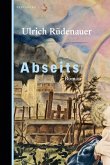
|
1954 in einem Dorf in Süddeutschland, der Krieg hängt den Menschen noch nach, es ist kein Platz für Sentimentalitäten und man möchte vergessen. Die (katholische?) Kirche hat leichtes Spiel mit ihrem Gefasel von Demut und Gnade, von Sünde und Erbarmen. Gottesfürchtigkeit beherrscht die Menschen. Man möchte Absolution, möchte sie verdrängen, diese Mittäterschaft, diese Mitwisserschaft in der Nazizeit. Und dann ist es ausgerechnet ein Kind, das einen täglich wieder damit konfrontiert. |
|
| Bewertung vom 05.10.2024 | ||

|
Düstere Zukunftsaussichten - ein Thriller mit Niveau |
|
| Bewertung vom 27.09.2024 | ||

|
»Alles ist gut«, ein Satz, der Trost spenden soll und doch so falsch ist. |
|
| Bewertung vom 25.09.2024 | ||

|
»Spatriati, so nennt man in Apulien die Unbestimmten, die aus der Art schlagenden, die Spinner, mitunter auch die Ziellosen und Alleinstehenden, kurz: die nicht dazugehören.« |
|
| Bewertung vom 22.09.2024 | ||

|
In der Familie Lieber verdrängt man gern unangenehme Themen, vor allem solche aus der Vergangenheit. Und so ist es kein Wunder, dass Heinrich erst mit 40 erfährt, dass seine leibliche Mutter kürzlich verstorben ist, und zwar in Island. Scheinbar gelassen nimmt Heinrich zunächst die Neuigkeiten auf, auch dass er noch eine Tante in Paris hat, hieß es doch immer, seine Familie sei verstorben. Doch das beschauliche, biedere Leben des korrekten Bauingenieurs aus Graubünden wird in den nächsten Wochen gehörig auf den Kopf gestellt. Nicht nur seine Karriere erleidet Schaden durch einen folgenschweren Fehler seinerseits. Und so nutzt Heinrich die Gunst der Stunde und reist nach Paris zu seiner Tante, um mehr über seine Mutter zu erfahren. Anschließend fliegt er nach Island, um ihr Grab zu besuchen, nichtsahnend, dass diese Reise zu einem Abenteuer werden wird. |
|
| Bewertung vom 21.09.2024 | ||

|
Wütend, eindringlich, poetisch |
|
