BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 501 Bewertungen| Bewertung vom 25.05.2023 | ||
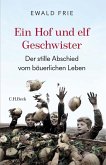
|
Niemals hätte ich gedacht, dass mich ein Buch über die Entwicklung der Landwirtschaft im Münsterland so begeistern könnte, vor allem, da es in meiner Familie seit mehreren Generationen keine Landwirte mehr gab. Aber Ewald Fries Herangehensweise an das Thema hat mich wirklich beeindruckt und ich habe sein Buch „Ein Hof und elf Geschwister“ sehr gern gelesen. Der Historiker hat seine eigene Familiengeschichte, die des Hofs Horst Nr. 17 bei Nottuln im katholischen Münsterland, in die allgemeine Geschichte des Wandels eingeflochten und eingeordnet, wodurch Zeitgeschichte ein Gesicht bekommt (die Namen seiner Familienangehörigen hat er anonymisiert, ihre Geburtsjahrgänge sind allerdings authentisch). Als Rahmen dient ihm eine Sammlung transkribierter Interviews, die er mit seinen Geschwistern geführt hat, seine Eltern sind inzwischen verstorben und kommen nur aus zweiter Hand zu Wort. Sein ältester Bruder ist im Jahr 1944 geboren, die jüngste Schwester 25 Jahre später, von zwölf Kindern haben elf überlebt – auch im 20. Jahrhundert keine Selbstverständlichkeit. 3 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 25.05.2023 | ||
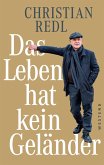
|
Das Leben hat kein Geländer (eBook, ePUB) Christian Redl kenne ich hauptsächlich als Kommissar Krüger aus den „Spreewald-Krimis“ im ZDF, aber auch als Darsteller kauziger und undurchsichtiger Charaktere in anderen Filmen. Jetzt hat der preisgekrönte Schauspieler, Musiker und Hörbuchsprecher mit „Das Leben hat kein Geländer“ eine Art Autobiografie veröffentlicht, ein Buch, das mich sehr zwiegespalten zurücklässt. |
|
| Bewertung vom 11.05.2023 | ||

|
Ich hätte nie im Leben gedacht, dass mich ein Jugendthriller jemals so richtig begeistern könnte. Ich dachte auch, „Dreivierteltot“ von Christina Stein wäre eine nette Lektüre für nebenher, mehr aber auch nicht. Aber da lag ich vollkommen falsch. Das Buch hat mich nach kurzer Zeit mitgerissen und das Ende so überrascht, dass ich erst einmal nach Luft schnappen musste. |
|
| Bewertung vom 04.05.2023 | ||
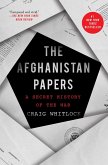
|
Am 7. Oktober 2001 begannen die USA damit, Afghanistan zu bombardieren und starteten damit den längsten Krieg in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Der Militäreinsatz dort dauerte länger als die Beteiligung an beiden Weltkriegen und der komplette Vietnamkrieg zusammen, nämlich ganze 20 Jahre. Dass dieser Krieg ein einziges Fiasko war und wie es dazu kommen konnte, hat der Investigativjournalist Craig Whitlock in seinem Buch „Die Afghanistan Papers. Der Insider-Report über Geheimnisse, Lügen und 20 Jahre Krieg“ zusammengetragen. Ein bedrückender Zusammenschnitt über Kämpfe, Illusionen, Lügen, Drogen und viel zu viele Tote auf allen Seiten. Eine Chronik des politischen Versagens auf ganzer Linie. |
|
| Bewertung vom 02.05.2023 | ||

|
Hand aufs Herz: wer kennt die Galapagos-Affäre? Ich schätze, die wenigsten. Denn so ging es mir auch, bevor ich Werner Köhlers Roman „Die dritte Quelle“ gelesen habe. Denn der Autor lässt seinen Protagonisten Harald Steen eine reale Geschichte aus den 1930er Jahren nachspüren. Der etwas schrullige Hamburger sucht auf Floreana, einer der Inseln der Inselgruppe, nämlich nichts Geringeres als seine Wurzeln. Und damit nimmt er die Leserschaft mit auf ein wildes Abenteuer, das mich beim Lesen mit seiner Spannung überrascht hat. |
|
| Bewertung vom 23.04.2023 | ||

|
„Wer – wie – was – warum“ – das kennen viele sicher aus der Sesamstraße. #DerApotheker beginnt jedes Kapitel seines zweiten Buchs „#derApotheker für alle Fälle“ mit einem dieser Fragewörter und beantwortet dann jede Menge Fragen rund um Medikamente. Wie schon beim ersten Buch habe ich sehr viel Neues erfahren und eine Menge dazugelernt. Eine wirklich lohnende Lektüre! |
|
| Bewertung vom 23.04.2023 | ||

|
Vorab möchte ich sagen, dass ich Biografien und Autobiografien sehr gerne lese. Eigentlich. Denn die Autobiografie von Nigel Kennedy fand ich dann doch, wie man neu-deutsch sagt, ein bisschen drüber. „Mein rebellisches Leben“ heißt das Werk und das „Rebellische“ ist darin auch der rote Faden. Allerdings nicht nur inhaltlich, sondern auch sprachlich. Daher konnte ich dem eher vulgären und chaotischen Buch wenig abgewinnen, es brachte mir den Künstler auch nicht wirklich näher. |
|
| Bewertung vom 08.04.2023 | ||
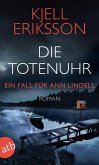
|
Die Totenuhr / Ann Lindell Bd.9 „Die Totenuhr” von Kjell Eriksson war für mich das erste und ganz sicher auch das letzte Buch seiner Reihe um Ann Lindell, die ehemalige Kriminalkommissarin. Der neunte Teil der Serie ist ein atmosphärischer Krimi, das ist für mich aber eines der wenigen positiven Dinge, die ich darüber sagen kann. Selten hat sich ein Buch für mich so zäh und mit so wenig Spannung gelesen und selbst der überraschende Schluss ließ mich völlig unbefriedigt zurück. Immer wieder war ich versucht, quer zu lesen, die verschiedenen Handlungsstränge und die Angst, etwas Wichtiges zu verpassen, hielten mich allerdings davon ab. |
|
| Bewertung vom 03.04.2023 | ||

|
„Die wichtigsten grundlegenden Gesetze und Tatsachen der Physik sind entdeckt und daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie jemand durch neue Entdeckungen ergänzt, äußerst gering.“ – diese Aussage des amerikanischen Physikers Albert Michelson stammt aus dem Jahr 1899. Für ihn war die Physik also „vollendet“. Wie falsch er lag, kann man in Tobias Hürters Buch „Das Zeitalter der Unschärfe nachlesen, denn die „glänzenden und die dunklen Jahre der Physik“ sollten erst noch kommen. Was mit Henri Becquerel und Marie Curie und der Entdeckung der Radioaktivität begann, mit dem Bohrschen Atommodell und den Relativitätstheorien weiterging und zur Quantentheorie und der Quantenmechanik führte, revolutioniert Wissenschaft, wissenschaftliches Denken und die ganze Welt – und endet mit den Abwürfen der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. |
|
| Bewertung vom 20.03.2023 | ||

|
Was für ein Finale! |
|
