BenutzerTop-Rezensenten Übersicht

Bewertungen
Insgesamt 188 Bewertungen| Bewertung vom 02.11.2023 | ||
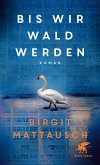
|
Babulya, eine Russlanddeutsche, verlässt mit ihrer nur wenige Monate alten Urenkelin ihre Heimat und übersiedelt wie viele andere auch nach Deutschland, der Heimat ihrer Vorfahren. Diese Russlanddeutschen sind keine Flüchtlinge und keine Vertriebenen, auch wenn vielen das Schicksal der Vertreibung durch die Politik Stalins vertraut ist; sie sind Umsiedler bzw. Spätaussiedler, die im Zuge der Ostpolitik vor allem in den 80er Jahren in die Bundesrepublik wechselten. |
|
| Bewertung vom 30.10.2023 | ||
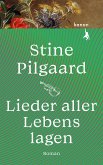
|
Ein junges Paar zieht in ein genossenschaftliches Mehrfamilienhaus. Von dieser alltäglichen Situation geht die Autorin aus, und Kapitel für Kapitel lernt der Leser nun die anderen Mitbewohner kennen, die der Zufall hier zusammengebracht hat: Singles, Paare, Familien, alle in unterschiedlichen Lebensphasen und mit unterschiedlichen Sorgen und Nöten belastet. Das Dachgeschoss entwickelt sich zu einem gemeinsamen Treffpunkt der Wohngemeinschaft, hier kreuzen sich die Wege, werden Neuigkeiten ausgetauscht und die Gemeinschaft wird lebendig gehalten. |
|
| Bewertung vom 27.10.2023 | ||
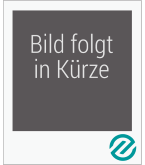
|
Glutspur / Liv Jensen Bd.1 (MP3-Download) Engberg, Glutspur |
|
| Bewertung vom 20.10.2023 | ||

|
„Die Scham über die Armut war meine eigentliche Kleidung.“ 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 15.10.2023 | ||
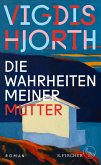
|
Mein Hör-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 13.10.2023 | ||
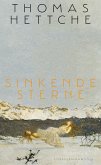
|
Eine Naturkatastrophe größeren Ausmaßes steht am Beginn dieses Buches: ein Bergsturz im unteren Wallis hat das Tal verschüttet, die Rhone wurde zurückgestaut und bildet nun einen gewaltigen See, der die Dörfer des Tals in sich begräbt. Der Autor hält sich nicht auf mit Erläuterungen oder Hinweisen zu den vermutlichen Ursachen des Bergsturzes. Kein Wort über Dauerregen, Gletscherschmelzen, Klima und dergleichen, sondern er kommt sofort zu seinen eigentlichen Themen. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 12.10.2023 | ||
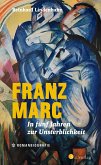
|
Franz Marc. In fünf Jahren zur Unsterblichkeit „,Das reine Blau steht für ... stark, herb, durchgeistigt.“ |
|
| Bewertung vom 08.10.2023 | ||
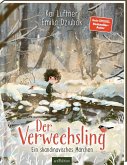
|
Der Verlag empfiehlt das Buch für Leser ab 6 Jahren, und also habe ich es K., unserem 7jährigen Enkelliebchen, vorgelesen und ihm auch die Beurteilung überlassen. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 07.10.2023 | ||
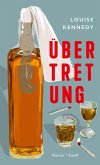
|
Eine Welt voller Hass und Gewalt im Irland der 70er Jahre öffnet sich in diesem Buch. Der Leser erlebt die irischen "troubles" aus der privaten Sicht von Cushla Laverty, einer jungen Lehrerin in Belfast. Trotz der Waffenruhe ist das tägliche Leben von Bombenattentaten, gewalttätigen und grausamen Übergriffen, Überwachung und von Polizeiwillkür gepägt. Cushla und ihre Familie gehören zur katholischen Minderheit in einem durchwegs protestantisch bewohnten Viertel. Sie wohnt noch bei ihrer Mutter, einer Alkoholikerin, und abends hilft sie ihrem Bruder in dessen Pub aus. Hier lernt sie den protestantischen Anwalt Michael kennen, mit dem sie schließlich eine leidenschaftliche Affäre beginnt. |
|
| Bewertung vom 01.10.2023 | ||
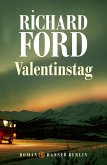
|
Frank Bascombe, dieser amerikanische Durchschnittsmann, ist wieder da. Wie sein Autor, der demnächst 80 Jahre alt wird, ist auch Frank Bascombe gealtert: er ist 74. Franks Leben steht vor einer besonderen Herausforderung. Sein Sohn Ralph ist bereits früh verstorben, die Ehe zerbrach an diesem Verlust, und nun begleitet er seinen Sohn Paul, der an der tödlichen Krankheit ALS leidet und bald sterben wird. |
|
