BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 874 Bewertungen| Bewertung vom 01.04.2022 | ||

|
Wahrhaftig und ungeniert schnodderig |
|
| Bewertung vom 28.03.2022 | ||

|
Wortlos verbunden |
|
| Bewertung vom 27.03.2022 | ||

|
Mehr Essay als Roman |
|
| Bewertung vom 25.03.2022 | ||

|
Politisches Terra incognita |
|
| Bewertung vom 22.03.2022 | ||
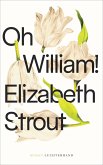
|
Auf der Suche nach dem Bindemittel |
|
| Bewertung vom 21.03.2022 | ||

|
Reise mit Clara durch Deutschland Das glücklichste Buch |
|
| Bewertung vom 18.03.2022 | ||

|
Ein von Schatten begrenzter Raum Kunst als Ersatzheimat 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 16.03.2022 | ||

|
Irrlichternde Erzählerstimme |
|
| Bewertung vom 10.03.2022 | ||
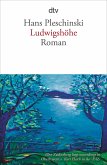
|
Der Tod als Programmfehler |
|
| Bewertung vom 07.03.2022 | ||

|
Redundanter Lebensgefühls-Roman |
|
