BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 177 Bewertungen| Bewertung vom 28.12.2022 | ||

|
»Dann der Gedanke :Hör auf zu denken. Immer denkst du. |
|
| Bewertung vom 28.12.2022 | ||

|
»Der Körper selbst muss der Thron sein. So! Lehnen Sie sich ein wenig zurück. Ja, genau so. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Diwan. Man muss Lust bekommen, sich auf Sie drauf zu legen.« |
|
| Bewertung vom 28.12.2022 | ||
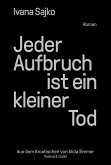
|
Jeder Aufbruch ist ein kleiner Tod »Die Kindheit ist eine Fotografie, die aufgehört hat, eine Fotografie zu sein, da auf ihr beinahe nichts mehr zu sehen ist, die Farben sind verblasst... die Flecken, die durch die Oxidation entstanden sind, sollte man durch eine Erzählung ersetzen, die vielleicht erfunden ist. « |
|
| Bewertung vom 28.12.2022 | ||
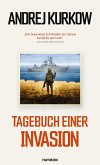
|
»Am 24. Februar 2022 schrieb ich kaum etwas auf. Vom Geräusch russischer Raketenexplosionen aufgeweckt, stand ich etwa eine Stunde lang am Fenster meiner Wohnung in Kyjiw und schaute auf die leeren Straßen hinunter, in dem Bewusstsein, dass der Krieg ausgebrochen war, jedoch noch unfähig, diese neue Realität zu akzeptieren.« |
|
| Bewertung vom 28.12.2022 | ||

|
So etwas kann schief gehen. Ein Musiker. Einer der ganz Großen. Eine Autobiografie. Keine Autobiografie. Ein Gespräch. Ein anderer Musiker. Musikjournalist. Viele Gespräche. Telefongespräche während der Pandemie. So etwas kann schnell nach Merch und nach Langeweile riechen. |
|
| Bewertung vom 28.12.2022 | ||

|
»Austern«, welch ein sinnlicher Genuss es war, dem sinnieren über unser Verhältnis zu Austern zu folgen. Von einer »𝑝𝑜𝑒𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑑 𝑧𝑢𝑔𝑙𝑒𝑖𝑐ℎ 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑛 𝑆𝑝𝑒𝑖𝑠𝑒«; zu erfahren, dass sie ihr Geschlecht wechselt, manche Arten mehrmals im Jahr, dass 1998 leise die industrielle Befruchtung und Vermehrung Einzug fand. Der Autor zitiert und bezieht sich auf alles Mögliche. Er begegnet den Austern leidenschaftlich und poetisch, er reist ihnen geschichtlich und örtlich hinterher, er dinniert im NOMA und isst sie immer wieder mit Genuss. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 28.12.2022 | ||

|
Olga Ravn wirft uns mit Die Angestellten ins 22. Jahrhundert auf ein Raumschiff mit Menschen, Humanoiden und rätselhaften Gegenständen. Etherisch-poetisch lesen sich die nüchtern gehaltenen Miniaturen aus dem Weltall. Spherisch hallen die nummerierten Zeugenaussagen der Besatzung von Schiff Sechstausend in uns wider. Es soll untersucht werden, welche Beziehungen die Angestellten mit den Gegenständen haben mit dem Ziel der Steigerung der Arbeitsabläufe und der Produktivität. Die Forschenden bleiben unsichtbar und greifen scheinbar nicht ein in das Geschehen und die Objekte ihrer Untersuchung, oder sind es Subjekte? |
|
| Bewertung vom 07.11.2022 | ||

|
Wir erleben den Kosmos einer Frau, die psychotisch ist, sie hat eine Scheibe zwischen sich und der Welt, im »Kopf ein Brei an Lauten«, schwimmende Stimmen. Rück-, oder Vorblenden gibt es nicht, auch müssen wir uns einige Kontexte erschließen. |
|
| Bewertung vom 07.11.2022 | ||
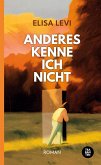
|
»Ich weiß ja nicht, wo sie herkommen, aber von hier läuft man weg und kommt nicht wieder. Wir sind verflucht. Unser Fluch ist ein Wald, aus dem es keinen Ausweg gibt.« |
|
| Bewertung vom 07.11.2022 | ||
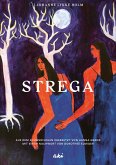
|
»Ich betrachtete mich selbst im Spiegel. Ich erkannte das Bild einer jungen, aber gefallenen Frau. Ich beugte mich vor und drückte den Mund gegen den Spiegel. Der Wasserdampf beschlug das Glas wie Kondensat in einem Zimmer, in dem jemand tief geschlafen hat, wie ein Toter. Hinter mir sah ich das Zimmer widergespiegelt. Im Bett lagen Haarnadeln, Schlaftabletten und ein Baumwollschlüpfer. Auf dem Laken waren Flecken von Milch und Blut.« |
|
