BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 174 Bewertungen| Bewertung vom 28.11.2015 | ||

|
Wittgenstein sucht ein Nashorn. Weil er die Aussage „Hier gibt es kein Nashorn“ so lange für falsch erachtet, wie sie nicht bewiesen wird. Wie aber beweist man, dass etwas nicht ist, wenn der einzige Beweis seine Nichtexistenz ist, die Existenz aber gedacht und ausgesprochen werden kann. Ein bildlicher Ansatz hilft, das Problem zu verdeutlichen und führt Wittgenstein auf eine Suche durch die Welt bis in den ersten Weltkrieg hinein. |
|
| Bewertung vom 28.11.2015 | ||

|
In einer unbestimmten, fernen Zukunft ist die Vergangenheit ein rotes Tuch. WAS GESCHEHEN IST, FALLS ES GESCHEHEN IST, ist das große Ereignis, das ominös und andeutungsvoll schrecklich ein Volk ausgelöscht haben soll. Niemand spricht über sie, selbst Andenken und Familienerbstücke sind gesetzlich begrenzt, doch viele verstoßen gegen diese Gesetzte. Zu ihnen gehört auch Kevern, Drechsler und Einzelgänger. Als er auf Ailinn trifft lernt er die große Liebe kennen. Sie finden zueinander und trotzen kleineren Hürden. Doch ein gemeinsames Geheimnis, das sie vom Rest der Welt unterscheidet, stellt alles auf die Probe. |
|
| Bewertung vom 20.11.2015 | ||
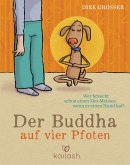
|
Dieses Jahr bei Kailash erschienen ist mit 231 Seiten Der Buddha auf vier Pfoten von Dirk Grosser. |
|
| Bewertung vom 20.11.2015 | ||

|
Mara Hvistendahl hat jahrelang in China gelebt und dabei gesehen, wie Mädchen immer seltener in den Klassenzimmern zu sehen sind. Sie hat sich gefragt, warum das so ist und sich auf die Suche nach den verschwundenen Frauen gemacht. Was sie dabei herausgefunden hat, ist erschreckend und bedenklich. In Gesprächen mit Ärzten, Wissenschaftlern, Eltern und Beamten fasst sie zusammen, warum und wie bereits ungeborene aufgrund ihres Geschlechts selektiert werden und was das für Folgen für uns alle hat. |
|
| Bewertung vom 01.11.2015 | ||

|
Sean Brummel: Einen Scheiß muss ich (Restexemplar) Sean Brummel ist der Inbegriff des amerikanischen Stereotyps unserer Gesellschaft. Faul, biertrinkend, einfältig. Homer Simpson ohne Gelb. Als er betrunken festgenommen wird und ihm ein Officer sagt: „Einen Scheiß muss du“ wird dieser Satz sein Mantra. Kurzerhand macht er nur noch, was er will und nicht mehr, was er „muss“. Er lässt sich scheiden, kündigt, wird Bierbrauer und findet eine neue Freundin. Ist das Leben nicht schön? Und weil es für Sean so einfach war, schreibt er kurzerhand einen Ratgeber, der allen Menschen helfen soll, sich vom „Mussmonster“ zu befreien. 1 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 01.11.2015 | ||

|
Mama Eule lässt die kleine Eule kurz allein zu Hause, um Abendessen zu holen. Die kleine Eule verspricht, niemanden rein zu lassen, denn sie ist ja schon groß. Als aber Mama Eule zurückkommt, bleibt die Tür verschlossen, denn die kleine Heule Eule hält sich an ihr versprechen und glaubt nicht, dass wirklich ihre Mama vor der Tür steht. Eichhörnchen, Hirschkäfer und Rabe müssen helfen, ehe die Heule Eule überzeugt ist. |
|
| Bewertung vom 30.10.2015 | ||

|
In neun Kapiteln beleuchten die Autoren verschiedene philosophische Fragen. Dabei geben sie immer zunächst ein philosophisches Gespräch mit Kindern wieder, anhand dessen sie das Thema einführen und gleich auch ein Beispiel aufzeigen, wie so ein Thema mit Kindern angegangen werden kann. In einem zweiten Schritt ist jedem Kapitel ein etwas fachlicherer Teil angefügt, der detaillierter und umfangreicher das behandelte philosophische Problem angeht. 0 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 26.10.2015 | ||

|
Reich-Ranicki geht systematisch vor und der Kritik dabei auf den Grund. Er beginnt bei den von ihm aufgezeigten Anfängen der Kritik in Deutschland und zitiert dabei einen französischen Aufsatz, der die Deutschen ganz schön schlecht wegkommen lässt. Die Unfähigkeit der Deutschen zur Kritik und auch die große Gegenwehr der deutschen Autoren wird dabei durch verschiedene Beispiele und Zitate belegt. Reich-Ranicki ist dabei aber nicht dogmatisch, sondern lässt Raum und wägt das für und wieder ab. |
|
| Bewertung vom 25.10.2015 | ||

|
Wer sind diese Kinder und warum sagen sie Mama zu mir? Ihre persönliche Geschichte vom Mamawerden und Mamasein erzählt Daniela Oefelein in Wer sind diese Kinder und warum sagen sie Mama zu mir, erschienen kürzlich bei Kösel mit 192 Seiten. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|