BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 177 Bewertungen| Bewertung vom 07.11.2022 | ||
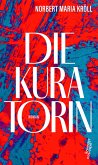
|
Wir können die Kuratorin auf den ersten Seiten nur abstoßend finden. Sie ist kalt, kalkulierend, hart, ehrgeizig und sie möchte immer höher hinaus. Sie verachtet fast alles. Die Kuratorin hat nur eine Freundin und sie ist überzeugt, wenn jemand Sex mit ihr will, dann nur, weil er sich einen Vorteil erhofft. Doch dann passiert ein Unfall mit einem jungen Künstler. Ein Kondom platzt, die Pille danach versagt und etwas in ihr entscheidet sich gegen eine Abtreibung. Ihre einzige Freundin wünscht sich schon lange ein Kind, so scheint sich eine perfekte Lösung aufzutun. |
|
| Bewertung vom 07.11.2022 | ||

|
Theresa lebt ein ganz normales deutsches Großstadtleben. Ihre neue Beziehung mit Erk fühlt sich gut an, die Bürogemeinschaft auch okay und Kinder sind nichts, was sie im Jetzt in Erwägung zieht. Oder doch? Sie nimmt Folsäure ein, geht zur Frauenärztin und in einer Mittagspause der Schock, die Verwirrung, zwei Striche, schwanger. Wenn ich Mutter bin, denkt Theresa, stillen, nein, Erk und ich werden die Care-Arbeit teilen. Ich werde nicht abtauchen, wie Isabell mir schon jetzt vorwirft. Ich werde mich im Beruf nicht zerreißen. Ich werde kein großes Ding um Schwangerschaft und Geburt machen, ins Krankenhaus gehen, wird schon klappen. Ich werde zurecht kommen mit der Mutter von Erk, die Mikroaggressionen verteilt. Wie meine Mutter, nein, nein, nein. Theresa ahnt, dass ein Zuviel auf sie einströmen wird. |
|
| Bewertung vom 07.11.2022 | ||
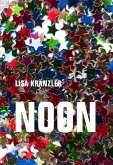
|
»Pumpend entlade ich mich ganz gut. Zum Bersten geladen bin ich, wenn gesund und genährt. Auch malend kann man sich entladen. Was ich lernen will: meine Kraft in den Text pumpen; mit Druck an die Maschine gehen und dabei nicht wahnsinnig werden, mich schreibend verausgaben; das Kribbeln in den Schenkeln in Konzentration verwandeln, allen Strom ins Hirn (ab)leiten, den allzu lebendigen Leib vor den Karren der Sprache spannen. Druck zeugt Sprachgewalt pro Papierfläche: Diese Utopie wahr zu machen wohl meine Lebensaufgabe.« |
|
| Bewertung vom 07.11.2022 | ||
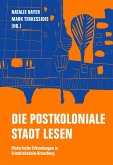
|
Ausgehend von Straßen, Bauten, Plätzen und historischen Personen werden die koloniale Vergangenheit und die postkoloniale Gegenwart Friedrichshain-Kreuzbergs in unser Bewusstsein gerückt. |
|
| Bewertung vom 07.11.2022 | ||

|
Wenderoman über Tabus von Mutterschaft |
|
| Bewertung vom 18.09.2022 | ||
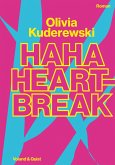
|
»Der Moment, in dem ich mich in dich verliebt habe, war richtig dämlich. Ich habe dir das nicht erzählt, weil ich mich im Nachhinein dafür geschämt habe, dass ich so billig zu haben war: Es lief ein Song... |
|
| Bewertung vom 14.09.2022 | ||

|
Ach, Emily, besonders warst du, besonders und speziell, sofern wir von dir wissen. Überliefert ist dein Leben in Fragmenten, das wir mit der lyrischen Biographie von Dominique Fontiere zu greifen versuchen und nicht zu greifen bekommen. Nicht ganz, denn es bleiben Lücken, Leerstellen und doch, es wird deutlich, die innere Welt von dir ist bunt, laut, die äußere ist gleißend weiß und still. |
|
| Bewertung vom 14.09.2022 | ||

|
Dry ist ein direktes autofiktionales Buch. Die Stärke von Autofiktion ist, dass sie Nähe herstellt, ohne dass wir die gleichen Erfahrungen gemacht haben müssen. Sie kann Scham überwinden helfen und eine innere Auseinandersetzung provozieren. Dabei ist es eine Gratwanderung, denn in solch einer rohen Form wie hier, ist damit kaum Schutz der Privatsphäre zu spüren. |
|
| Bewertung vom 14.09.2022 | ||

|
Im Herzen eines goldenen Sommers »Sie haben aber zu viele Bücher. Wie wollen Sie sich da zurecht finden? Vermischen Sie nicht sämtliche Geschichten? Ach, das ist nicht schlimm? Das sehe ich aber anders! Wenn man Sie zu einem Buch befragt, sollten Sie es nicht verwechseln, sonst hält man Sie am Ende noch für verwirrt. Außerdem erzählt jedes Buch eine bestimmte Geschichte und keine andere. Wäre ich Schriftstellerin wie Sie, würde es mir kein bisschen gefallen, wenn man meine Bücher mit anderen verwechselt.« |
|
| Bewertung vom 14.09.2022 | ||
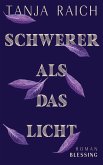
|
»Sie sah Wellen, konnte jedoch kein Rauschen hören, als wäre eine Wand zwischen ihr und der Welt.« |
|
