BenutzerTop-Rezensenten Übersicht

Bewertungen
Insgesamt 188 Bewertungen| Bewertung vom 30.07.2023 | ||
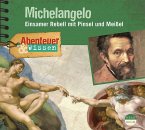
|
Abenteuer & Wissen: Michelangelo Die Reihe „Abenteuer Wissen“ widmet sich hier einem Giganten der Kunstgeschichte: Michelangelo. Mit einer kleinen Hörspielszene zur kräftezehrenden Ausmalung der Sixitnischen Kapelle startet das Feature und bringt damit Michelangelo über die Jahrhunderte hinweg nahe an den Hörer heran. |
|
| Bewertung vom 28.07.2023 | ||
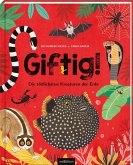
|
Ein spannendes Thema! |
|
| Bewertung vom 28.07.2023 | ||

|
Seethalers Vorliebe gehört offensichtlich den einfachen, kleinen Leuten, deren Leben er erzählt. Hier ist es die Geschichte des Gelegenheitsarbeiters Robert Simon, der Ende der 60er Jahre ein Cafè am Karmelitermarkt übernimmt, einem noch vom Krieg gezeichneten ärmlichen Viertel Wiens. Sein Leben ist unspektakulär und von täglicher harter Arbeit geprägt. Er wohnt bescheiden in einem möblierten Zimmer bei einer Kriegerwitwe, mit der ihn im Lauf der Jahre das Gefühl einer gegenseitigen Verantwortung füreinander verbindet. |
|
| Bewertung vom 27.07.2023 | ||
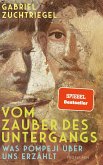
|
„Vom Zauber des Untergangs“. Dieser Titel befremdet zunächst. Welchen Zauber hat der Untergang einer ganzen Stadt? |
|
| Bewertung vom 26.07.2023 | ||
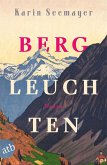
|
Mein Hör-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 18.07.2023 | ||
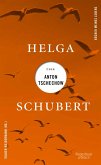
|
Helga Schubert über Anton Tschechow / Bücher meines Lebens Bd.4 „Bücher meines Lebens“ – so lautet der Titel einer Buchreihe, die Volker Weidermann im Verlag Kiepenheuer & Witsch herausgibt. Der Reihentitel macht die Sache spannend. Gibt es Bücher, die das Leben der Autoren maßgeblich beeinflusst haben, es verändert haben? Die ihn langfristig begeistern, aus welchem Grund auch immer? Haben die Verfasser eine besondere Affinität zu einem Autor, und wenn ja, warum? Lassen sie sich künstlerisch in ihrem eigenen Schaffen von seinem Werk beeindrucken? Der Titel lässt das alles offen, aber auf alle Fälle erwartet den Leser eine sehr persönliche Auseinandersetzung. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 17.07.2023 | ||

|
„Es gibt mehr als nur eine Art zu lieben!“ |
|
| Bewertung vom 13.07.2023 | ||

|
Ein Requiem der besonderen Art! |
|
| Bewertung vom 04.07.2023 | ||
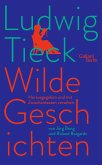
|
Kaum zu glauben: eine Werksammlung von Ludwig Tieck, dieses begnadeten Romanschreibers, Novellendichters, Lyrikers, Dramaturgen etc. und Übersetzers, steht immer noch aus. Umso schöner, dass Jörg Bong und Roland Borgards sich entschlossen haben, dem Meister ein besonderes Geschenk zu seinem 250. Geburtstag zu machen: die Herausgabe von 11 seiner frühen Geschichten. |
|
| Bewertung vom 04.07.2023 | ||
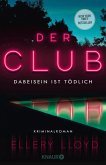
|
Der Club. Dabeisein ist tödlich Das Setting erinnert an einen Agatha-Christie-Roman: eine Insel als „locked room“, auf der sich auf eine Einladung hin einige Menschen versammeln, ein Mord geschieht, und Abgründe tun sich auf. |
|
