BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 154 Bewertungen| Bewertung vom 16.05.2024 | ||
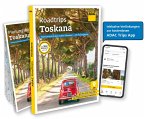
|
Reiseführer für die Toskana gibt es buchstäblich wie Sand am Meer, warum dann noch einen vom ADAC? Die Antwort steckt schon im Titel: Hier geht es um den klassischen Roadtrip mit PKW oder Motorrad und für diesen Zweck ist das neuartige Konzept ideal. Neben übersichtlichem Kartenmaterial (Teilkarten jeweils bei den Routen und eine Gesamtübersicht als herausnehmbare Faltkarte) gibt es anschauliche Routenbeschreibungen, wobei landschaftliche Highlights mindestens so im Fokus stehen, wie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Es ist kein Reiseführer à la Lonely Planet oder Loose, das heißt, man bekommt so gut wie keine Empfehlungen für Unterkünfte oder Verpflegung, kaum einmal Öffnungszeiten oder Eintrittspreise von Sehenswürdigkeiten und auch historische Informationen sind sehr spärlich gesät. Dafür sind die insgesamt fünf Routen wirklich ausgefuchst und decken die gesamte Toskana engmaschig ab. Alle irgendwie relevanten Ziele der Region liegen entweder direkt auf der Route oder sehr nahe daran. Das Besondere sind die Umsteigepunkte, an denen sich entweder Routen neu kombinieren oder abkürzen lassen, ohne dass man für die Übergänge lange Strecken zurücklegen muss. Je nach persönlicher Präferenz kann man die eigene Tour zusammenstellen. 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 15.05.2024 | ||
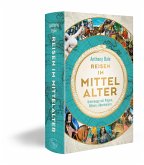
|
Das dunkle Mittelalter war gar nicht so rückständig und finster, wie es auch heute immer noch dargestellt wird. Die mittelalterliche Welt war über Kontinente hinweg vernetzt, sowohl über den Handel als auch den monastischen Austausch und die Fernrouten zeigten zu gewissen Zeiten fast schon Züge von Massentourismus. Rom und Jerusalem wurden im 15. Jahrhundert von Pilgern regelrecht geflutet, und es entstand parallel eine florierende Reiseliteratur, die an neuzeitliche Lonely Planet Ausgaben erinnert. Anthony Bale hat in seinem Buch Quellen vom 11. bis frühen 16. Jahrhundert für ein Laienpublikum aufgearbeitet und dabei ein überaus detailreiches und schillerndes Bild der Reisekultur gezeichnet. Gefährlich war das Reisen in jedem Fall, alleine schon durch die gesundheitlichen Risiken, aber auch Wegelagerer, Naturkatastrophen und das Klima machten den Reisenden zu schaffen. Auf der anderen Seite gab es schon im 13. Jahrhundert Strecken, die relativ sicher und für die damalige Zeit komfortabel zu bereisen waren (Marco Polo war z. B. NICHT der erste europäische Kaufmann im tatarischen China!). Herrscher aller Zeiten und Religionen haben immer wieder erkannt, dass Handel Wohlstand bringt und Handel nur blüht, wenn die Kaufleute sicher an ihr Ziel kommen. 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 05.05.2024 | ||

|
Meine digitale Sicherheit für Dummies Mit dem Internet kam die Cyberkriminalität: Erpressungstrojaner, Phishing-Mails, Identitätsdiebstahl, Social Engineering, Viren, Malware und Bots sind nur einige der Gefahren, die für Unternehmen existenzbedrohend sein können. Aber auch Privatpersonen werden immer wieder Opfer von Cyberattacken und erleiden finanzielle Schäden durch Betrugsmaschen. In ihrem Buch „Meine digitale Sicherheit für Dummies“ zeigen die IT-Experten Matteo Große-Kampmann und Chris Wojzechowski, wie man Risiken erkennt, richtig einschätzt und sich erfolgreich vor Lug und Betrug im Internet schützt. 3 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 04.05.2024 | ||
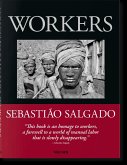
|
Sebastião Salgado. Arbeiter. Zur Archäologie des Industriezeitalters Sebastião Salgado gehört zu den besten lebenden Reportagefotografen der Welt und mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine. Er besitzt nicht nur die Fähigkeit zur Empathie, die aus jedem seiner Bilder spricht, sondern er beherrscht auch das Medium der analogen Fotografie wie kaum ein anderer. Zwar beschränkt er sich auf die s/w-Fotografie, aber eben diese Beschränkung fördert in besonderer Weise die Konzentration auf das Motiv. Salgado ist ein Meister des klassischen Bildaufbaus, wodurch selbst Szenen, die in ihrer sozialen Grausamkeit manchmal schwer erträglich sind, überhaupt erst darstellbar werden. Nicht selten dringt der Fotograf nämlich in Bereiche ein, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind und in solchen Fällen die Würde der Menschen nicht zu verletzen, ist eine große Kunst. Ich glaube, Salgado gelingt dies unter anderem dadurch, dass er Bilder von großer ästhetischer Schönheit schafft, die den Wert jedes einzelnen Protagonisten außer Zweifel lassen. Das gilt insbesondere für „Arbeiter“, einem Klassiker des Fotobuchs, der 1993 erstmals erschien und sofort ein internationaler Erfolg wurde. 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 03.05.2024 | ||
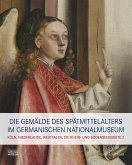
|
Die Gemälde des Spätmittelalters im Germanischen Nationalmuseum Nach fast 100 Jahren wird derzeit der erste Bestandskatalog der mittelalterlichen Malerei des Germanischen Nationalmuseums in mehreren Teilbänden publiziert, obwohl gerade dieses Themengebiet zu den Kernbereichen der Sammlung gehört. Der Bestand an spätmittelalterlicher Tafelmalerei bis 1500 gehört zu den bedeutendsten weltweit. Das dem Museum angegliederte Institut für Kunsttechnik und Konservierung besitzt ebenfalls Weltruf. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 29.04.2024 | ||
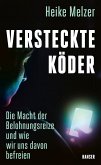
|
Warum Sie nur diese Rezension lesen sollten! 3 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 19.04.2024 | ||
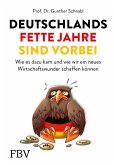
|
Deutschlands fette Jahre sind vorbei Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck definiert in seinem Jahreswirtschaftsbericht 2023 neben dem Bruttoinlandsprodukt 34 neue Wohlstandsindikatoren, darunter die Zahl der Windkraftanlagen, die Zahl der ausländischen Beschäftigten, Frauen in Führungspositionen oder Existenzgründungen durch Frauen. Doch hilft das Schönrechnen von Wachstum und das ideologische Framing nicht über die Tatsache hinweg, dass die deutsche Wirtschaft ins Straucheln geraten ist und wir bereits heute Wohlstand verlieren. Gunther Schnabl, Professor an der Universität Leipzig, analysiert in seinem Buch sachlich, nüchtern und allgemein verständlich die Gründe für den wirtschaftlichen Niedergang und den Kaufkraftverlust großer Teile der deutschen Bevölkerung und zeigt, dass Wohlstand nur durch Produktivitätssteigerung bei moderaten Sozialausgaben möglich ist. 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 17.04.2024 | ||
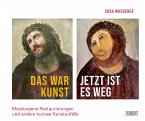
|
Das war Kunst, jetzt ist es weg Moderne Kunst sieht ja nicht selten aus, als wäre sie das Ergebnis eines Unfalls gewesen, aber das ist nicht das Thema von Vera Wucherers Buch. Auch hier geht es um Unfälle mit Kunst, aber eben die ungewollten. Geballte Zerstörung auf jeder Seite. Täter sind selbsternannte Restauratoren, eifrige Putzfrauen oder Hausmeister, unvorsichtige Besucher und überschwängliche Sammler. Eine unbedachte Bewegung und die Kunst ist weg, wobei ich mich nicht selten gefragt habe: Na und? Eine mit ranzigem Fett beschmierte Badewanne hat in sauberem Zustand sicher den höheren Nutzwert, auch wenn ich Beuys seinen persönlichen „Hurtz“-Moment gönne. 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 10.04.2024 | ||
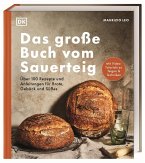
|
Mit Sauerteig zu backen, gilt als die backhandwerkliche Königsdisziplin. Ich bin selber ursprünglich über kommerzielle Backmischungen mit Sauerteiganteil und einen Brotbackautomaten zum Brotbacken gekommen. Mittlerweile stelle ich die Zutaten selbst nach Rezept und mit individuellen "Verfeinerungen" zusammen und backe das Brot im Backofen. Meistens erfolgreich, aber es gehen bis heute auch Versuche daneben. Spaß macht es aber immer und der Geschmack ist unerreicht. 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 07.04.2024 | ||
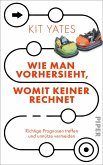
|
Wie man vorhersieht, womit keiner rechnet Crash-Propheten, die den Zusammenbruch der Börse voraussagen, gibt es viele und ab und zu behält einer von ihnen Recht. Doch mit Vorhersagen hat das wenig zu tun, wie Kit Yates in seinem Buch „Wie man vorhersieht, womit keiner rechnet“ anhand des Gesetzes der großen Zahl beweist: „Die riesige Zahl an Vorhersagen gibt selbst dem einsamen Propheten eine gute Chance, irgendwann einmal einen Treffer zu landen.“ In seinem populärwissenschaftlichen Buch greift Yates viele weitere Beispiele aus dem Alltag auf (z. B. aus der Corona-Pandemie) und erklärt, wie man bessere und möglichst evidenzbasierte Vorhersagen trifft. Dazu nutzt er objektive Ergebnisse und Werkzeuge der Mathematik, indem er Studien aus Biologie, Psychologie, Soziologie und Medizin mit Theorien aus Ökonomie und Physik verknüpft. Wichtig sind ihm dabei Bezüge zu Erfahrungen aus der realen Welt. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
