BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 182 Bewertungen| Bewertung vom 24.09.2021 | ||

|
Köln, 1952: Handwerker Willi soll in der Wohnung der etwa gleichaltrigen Margot und deren Sohn Fred eine Wand einziehen, um den beiden mehr Privatsphäre zu ermöglichen. Unverständlich für Willi, denn die Wand würde der Wohnung so viel Licht nehmen. Trotzdem strahlt Margot eine gewisse Magie aus, so dass sie Willi fortan nicht aus dem Kopf gehen mag. Ist das der Beginn einer großen Liebesgeschichte? |
|
| Bewertung vom 20.09.2021 | ||

|
Die Brüder Benjamin, Nils und Pierre kehren zum Sommerhaus ihrer Kindheit zurück, um den letzten Wunsch ihrer verstorbenen Mutter zu erfüllen. Ihre Asche soll dort verstreut werden. Doch die Zusammenkunft ist geprägt von Tränen und Gewalt. Was geschah vor gut 20 Jahren wirklich im Sommerhaus - und wie lässt sich damit leben? |
|
| Bewertung vom 20.09.2021 | ||

|
Als die zwölfjährige Sascha von ihren Eltern zum Großvater gefahren wird, ahnt sie noch nicht, dass sie dort ihre Heimat finden wird. Fernab vom sexuellen Missbrauch des Vaters und der lieb- und freudlosen Mutter lernt Sascha mit Charlie nicht nur eine Freundin kennen, sondern darf sich mit Rosa sogar erstmals in ihrem Leben einen Hund zulegen - eine folgenreiche Entscheidung, die den Zusammenhalt ihrer neuen Familie auf die Probe stellt... |
|
| Bewertung vom 15.09.2021 | ||

|
In einer nicht näher benannten Zeit lebt der elfjährige Waisenjunge Martin in einem Dorf als Ausgestoßener. Die Menschen fürchten seine Klugheit mindestens genauso sehr wie seinen ewigen Begleiter: einen schwarzen Hahn. Erst als ein Maler das Dorf betritt, wittert der Junge die Möglichkeit, seine Heimat zu verlassen - und sich auf die Suche nach den verlorenen Kindern zu machen, die jedes Jahr von einem mysteriösen Reiter entführt werden... |
|
| Bewertung vom 13.09.2021 | ||

|
Im Glasgow der 1980er-Jahre wächst der kleine Shuggie Bain in einer Arbeitersiedlung auf, in die er nicht hineinpasst. Er hasst Fußball, liebt das Tanzen - und seine Mutter Agnes, die dem Alkohol verfallen ist. Mit unbändigem Willen versucht er, sie zu retten und scheitert doch immer wieder. Erst nach und nach wird ihm klar, dass offenbar alle Mühe umsonst ist... |
|
| Bewertung vom 06.09.2021 | ||

|
Tod oder Taufe - Die Kreuzfahrer am Rhein Mainz, 1096: Während Rabbi Chaim und Domdekan Raimund trotz aller Glaubensunterschiede freundschaftlich miteinander verbunden sind, droht von außen eine große Gefahr für die Mainzer Juden. Vor den Toren der Stadt stehen die Kreuzfahrer, angeführt von Emicho von Flonheim und dem charismatischen Priester Rotkutte. Ihr Ziel: die Auslöschung des jüdischen Glaubens. Nach dem gewaltsamen Eindringen in die Stadt scheint sich für die bedrohte jüdische Minderheit nur noch eine Frage zu stellen: Tod oder Taufe? |
|
| Bewertung vom 26.08.2021 | ||
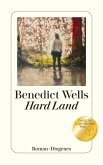
|
Der 15-jährige Sam langweilt sich in seinen Sommerferien 1985 in der Kleinstadt Grady in Missouri - bis er die Möglichkeit erhält, für das vor der Schließung stehende Kino "Metropolis" zu arbeiten. Dort lernt er mit Cameron und Hightower nicht nur neue Freunde kennen, sondern auch Kirstie - und mit ihr die Liebe. Doch während die jugendlichen Abenteuer immer intensiver werden, kämpft Sams krebskranke Mutter zuhause um ihr Leben. Und so erlebt Sam einen Sommer, den er nie wieder vergessen wird... |
|
| Bewertung vom 13.08.2021 | ||

|
2016 sorgte Emma Cline mit ihrem Debütroman "The Girls" auch in Deutschland für Aufsehen. Dass sie mit "Daddy" eine Sammlung von Erzählungen folgen lässt, ist eine mutige Entscheidung - die sich allerdings gelohnt hat. Sieben der zehn Storys sind in den vergangenen Jahren bereits in namhaften Magazinen wie dem "New Yorker" erschienen, doch den meisten deutschen Leser:innen vermutlich unbekannt. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 10.08.2021 | ||

|
Fabian ist 20, als er 1975 erstmals in die DDR reist, um die Brieffreundin seiner Tante und deren Familie in Dresden zu besuchen. Es entwickelt sich eine langjährige Freundschaft, in deren Verlauf Fabian merkt, wie sich die Hoffnungen und Wünsche der Familie Gersberger ändern. Und auch Fabian selbst verändert sich durch seine Erfahrungen in dieser Familie - und deren unerschütterlichen Zusammenhalt... |
|
| Bewertung vom 01.08.2021 | ||

|
Im Dezember 1939 prallen im sachsen-anhaltinischen Genthin zwei Züge aufeinander. Bis heute ist es das schwerste Zugunglück der deutschen Geschichte. Der in Genthin geborene Gert Loschütz widmet ihm seinen neuen Roman "Besichtigung eines Unglücks". Es ist ein in jeder Hinsicht bemerkenswerter Roman geworden. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
