BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 182 Bewertungen| Bewertung vom 29.07.2021 | ||

|
2018 sterben innerhalb von vier Monaten die Eltern des Autoren. Wie überlebt man solche Schicksalsschläge, wie geht man mit ihnen um? Darüber schreibt Christian Dittloff in seinem Buch "Niemehrzeit". |
|
| Bewertung vom 29.07.2021 | ||

|
Wie viel von diesen Hügeln ist Gold Die von chinesischen Einwanderern abstammenden Geschwisterkinder Lucy und Sam begeben sich im Wilden Westen des ausgehenden 19. Jahrhunderts mit dem gestohlenen Pferd Nellie auf eine abenteuerliche Reise. Ihre schwere Last: eine Truhe der verstorbenen Mutter, darin die Leiche des Vaters. Doch die beiden sind nicht nur auf der Suche nach einer Begräbnisstätte... 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 19.07.2021 | ||

|
Kulturwissenschaftler Theo steckt mit 40 Jahren in einer Lebenskrise. Beruflich und privat scheint es keine großen Veränderungen zu geben, zudem vereinsamt er immer mehr. Gut, dass ihm im Urlaub die Idee kommt, gemeinsam mit seinem neunjährigen Sohn Moritz, eine waghalsige Reise zu unternehmen: Die beiden wollen sich - in entgegengesetzter Richtung - auf die Spuren des Elefanten Soliman begeben, der Mitte des 16. Jahrhunderts gemeinsam mit dem zukünftigen Kaiser Maximilian von Spanien aus über die Alpen nach Wien wanderte. Doch von Beginn an steht das Unternehmen unter keinem günstigen Stern... |
|
| Bewertung vom 09.07.2021 | ||
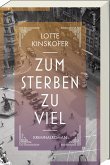
|
Pasing, 1922: In der Münchner Vorstadt wird der Heimatdichter Carus von Waldfels auf dem Weg zum Bahnhof ermordet. Die Leiche des erstochenen Dichters weist eine Verletzung an der Schläfe auf. Der Münchner Oberkommissär Benedikt Wurzer macht sich auf, das Rätsel um den Casanova zu lösen. Schnell findet sich mit dem Schreiner Benno Stöckl ein Verdächtiger, der zudem ein Motiv gehabt hätte: von Waldfels machte seiner Frau Agnes schöne Augen. Nach Bennos Verhaftung ist es vor allem Agnes, die den Kampf um ihren Mann nicht aufgeben mag... |
|
| Bewertung vom 30.06.2021 | ||

|
Auch wenn der Klappentext fälschlicherweise von einer Protagonistin namens Erika spricht, folgen wir in Wahrheit der Ich-Erzählerin I, die ihren eigenen Vornamen genauso auf den Anfangsbuchstaben reduziert wie die ihres Mannes und der beiden Kinder. I ist gerade mit M, Tochter E und Babysöhnchen B von den USA in die Schweiz, genauer nach Genf, gezogen. Ihr Mann ist beruflich so stark eingebunden, dass er kaum zuhause ist. Und so ist es an I, die Zeit mit ihren beiden Kindern in der kleinen, engen Wohnung zu verbringen. Ist sie einmal draußen, versteht sie noch nicht einmal die fremde Sprache. Und so zieht sich die Erzählerin nach und nach zurück, isoliert sich so stark, dass die Grenze zwischen Mutterliebe und Wahnsinn irgendwann so schmal ist, dass sie überschritten wird... |
|
| Bewertung vom 26.06.2021 | ||
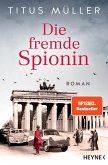
|
Die fremde Spionin / Die Spionin Bd.1 Im Ostberlin des Jahres 1961 erhält die 21-jährige Ria eine Stelle im Ministerium für Außenhandel. Was ihr Chef Alexander Schalck nicht weiß: Die junge Frau wurde kurz zuvor vom westdeutschen BND als Agentin engagiert. Ihr Motiv: Rache, denn mit zehn Jahren verlor sie aufgrund der Stasi nicht nur ihre Eltern, sondern wurde auch noch von ihrer jüngeren Schwester Jolanthe getrennt. Schlecht allerdings, wenn der Feind schnell Lunte wittert - und mit dem Top-KGB-Agenten Sorokin einen Mann auf sie ansetzt, der auch vor Morden nicht zurückschreckt... |
|
| Bewertung vom 20.06.2021 | ||

|
Der 26-jährige Aushilfslehrer Hendrik Vankel ist noch nicht wirklich angekommen in dem kleinen Ort in Nordnorwegen. Zwar genießt er bei seinen Schüler:innen durchaus hohes Ansehen, doch bis auf seinen etwa gleichaltrigen Kollegen Henning fühlt er sich die meiste Zeit über einsam. Als er sich in seine 13-jährige Schülerin Miriam verliebt, gerät sein Leben aus den Fugen - seine ganze Existenz fällt "aus der Welt". Aus Angst flüchtet er nach Kristiansand, den Ort seiner Jugend. Doch auch dort lassen ihn die Geister der Vergangenheit nicht ruhen... |
|
| Bewertung vom 08.06.2021 | ||

|
Der Antiquitätenhändler Maurice erhält durch die Übernahme eines Nachlasses ein kleines Salzfass, auf dessen Boden sich der Rest einer weißen Substanz befindet. Während sich daraus ein pilzartiges Geflecht bildet, leidet Maurice zunehmend unter einem seltsamen Brummen im Kopf. Beheben lässt sich dieses offenbar nur durch ein Füttern des Salzfasses. Als das Geflecht größer und größer wird, sieht Maurice keinen anderen Ausweg als sich vom Salzfass zu trennen. Doch niemand erbarmt sich und zeigt Interesse... |
|
| Bewertung vom 02.06.2021 | ||
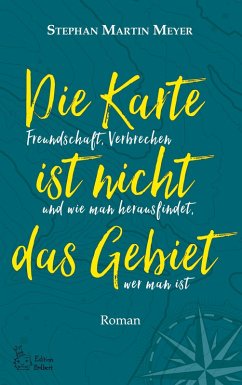
|
Die Karte ist nicht das Gebiet Der 14-jährige Johan ist unglücklich. Ausgerechnet sein bester Freund Nils umgibt sich nur noch mit Linus, dem Jungen, der Johan fast täglich mobbt und beleidigt. Da kommt es ihm gelegen, die Ferien wie gewohnt mit seinen Eltern in Südtirol zu verbringen, wo er auf Luise und Paul, zwei langjährige Ferienfreunde, trifft. Als bei einem Erdrutsch die gemeinsame Ferienpension zerstört wird und gar ein Todesopfer geborgen werden muss, bezweifeln die drei Jugendlichen, dass es sich dabei wirklich um einen Unfall handelt. Für weitere Aufregung sorgt Johans Verhältnis zu Paul, der mit seinen sexuellen Anspielungen nicht nur Johan verwirrt... |
|
| Bewertung vom 29.05.2021 | ||
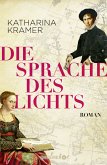
|
Europa im Jahre 1582: Während sich der sprachbegabte Lehrer Jacob Greve im sächsischen Pforta über seine unwilligen Schüler ärgert, tritt Margarète Labé in den Pyrenäen ihre Aufgabe als Übersetzerin und Spionin der Katholischen Liga an. Der Kontinent ist gespalten durch die Religionskriege zwischen Katholiken, Protestanten und anderen religiösen Gruppen. Einig sind sie sich offenbar nur in ihrer Suche nach der Sprache der Schöpfung, die Gott verwendet haben soll, um die Welt zu erschaffen. So scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich die Wege Margarètes und Jacobs in den Wirren der Religionskriege kreuzen... |
|
