BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 368 Bewertungen| Bewertung vom 14.05.2020 | ||

|
REZENSION – Ein belletristisch seltener Genuss ist der im März bei Dumont veröffentlichte Roman „Offene See“ des englischen Schriftstellers Benjamin Myers (44), weshalb man dem Verlag zu diesem Glücksgriff nur gratulieren kann. Es ist vor allem die in romantischen Bildern berauschende Sprache, die diesen ersten in deutscher Übersetzung erschienenen Roman des zuvor schon mehrfach ausgezeichneten Autors so fasziniert und berührt, weshalb auch den Übersetzern Klaus Timmermann und Ulrike Wasel für dieses literarische Erlebnis zu danken ist. |
|
| Bewertung vom 12.05.2020 | ||

|
REZENSION – Wer sich mit den möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unsere Gesellschaft beschäftigen will, kann viele Bücher lesen. Empfehlenswerter ist aber die Lektüre des kleinen, im Mai beim Luchterhand-Verlag erschienenen Büchleins „Trotzdem“. Wie schon in ihrem ersten beeindruckenden Gesprächsband über „Die Herzlichkeit der Vernunft“ (2017) überzeugen auch diesmal die beiden Schriftsteller-Juristen Ferdinand von Schirach (56) und Alexander Kluge (88) durch Intellekt, Scharfblick und Weitblick. Das gerade in seiner Kürze und Prägnanz beeindruckende, auf knapp 80 Seiten festgehaltene Gesprächsprotokoll der beiden Juristen beantwortet Fragen von der Rechtmäßigkeit heutiger Einschränkungen bis zur Zukunft Europas. 10 von 11 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 04.05.2020 | ||

|
REZENSION – Wer einen spannenden Unterhaltungsroman mit historischem Rückblick in die Zeit des Zweiten Weltkriegs sucht, macht mit dem 200-Seiten-Krimi „Der Himmel so rot“, dem dritten Buch von Marion Feldhausen, sicher keinen Fehler. Er verknüpft in lockerem Stil aktuelle gesellschaftspolitische Themen mit Kriegsverbrechen in Norditalien. Besser wäre allerdings gewesen, wenn Letzteres nicht schon im Klappentext des Romans verraten würde. Denn dadurch verliert der durchaus raffiniert aufgebaute Krimi einen wesentlichen Teil seiner Spannung. Doch das Tempo der Handlung, starke Szenenwechsel, kurze Sätze und gute Dialoge machen das Buch zu einem leicht und gern lesbaren Spannungsroman. 0 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 01.05.2020 | ||

|
REZENSION – Ist es ein Kriminalroman? Oder doch eine Liebesgeschichte? „Ich bin ein Laster“, der nur 140-seitige Debütroman der kanadischen Schriftstellerin Michelle Winters, ist beides - ein liebevoller Kurzkrimi, der zu Recht für die Shortlist des kanadischen Giller Prize 2017 nominiert war. In der tragikomischen Emanzipationsgeschichte geht es um Einschränkung, aber auch um Befreiung, um Liebe und Verlust, um Tradition und Aufbruch also um die Frage wohl eines jeden, was wir sind und was wir sein wollen. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 25.04.2020 | ||

|
REZENSION – „Realitätsnahe Bezüge mit gründlich recherchierten Fakten“ sind ihm besonders wichtig, sagt der unter dem Pseudonym Erik D. Schulz schreibende Arzt über seine Arbeit als Autor. Gleichzeitig geht es ihm um Spannung und Unterhaltung „durch eine intensive, emotionale Zeichnung der Romanfiguren“, verbunden mit „einer Portion Optimismus, der den Leser an die eigenen Stärken glauben lässt“. Dies alles trifft auf seine im März veröffentlichte postnukleare Dystopie „Der Weizen gedeiht im Süden“ zu. Nach vier Jugendromanen hat sich Erik D. Schulz erstmals an einen Roman für Erwachsene herangewagt – und dieses Wagnis ist gelungen. |
|
| Bewertung vom 21.04.2020 | ||
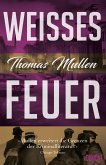
|
REZENSION – Noch spannender und interessanter als der erste Band „Darktown“ (2018) ist der im November im Dumont-Buchverlag veröffentlichte Folgeband „Weißes Feuer“ des amerikanischen Schriftstellers Thomas Mullen (46). Wieder geht es um den täglich sichtbaren und unsichtbaren Rassenkonflikt zwischen Schwarzen und Weißen in Atlanta, Hauptstadt des Bundesstaates Georgia, im Nachkriegsjahr 1950 und um die schwierige Arbeit der ersten acht, seit 1948 im Schwarzenviertel „Darktown“ eingesetzten Negro-Polizisten. Im Unterschied zum ersten Band, der die Tage direkt nach Gründung der vom Bürgermeister aus rein politischem Kalkül um Wählerstimmen geschaffenen Polizeieinheit aus nur wenigen Afroamerikanern schildert, sind die acht Darktown-Polizisten inzwischen auch mit Pistolen ausgerüstet, was die Gefahr möglicher rassistischer und persönlicher Konflikte noch erhöht. |
|
| Bewertung vom 13.04.2020 | ||

|
Maigret in der Liberty Bar / Kommissar Maigret Bd.17 Bisher kannte ich keinen der 120 Romane und 150 Erzählungen des Belgiers Georges Simenon (1903-1989), weder einen seiner Krimis mit dem ewig Pfeife rauchenden Kommissar Maigret noch einen seiner Non-Maigret-Romane. Nachdem ich nun dank eines Überraschungspakets des Atlantik-Verlags, der gerade die Neuübersetzungen Simenons herausbringt, zunächst den 1948 erstmals und nun im November 2019 veröffentlichten Roman "Der Schnee war schmutzig" gelesen hatte - ganz ohne Maigret und kein Krimi -, der mir ausnehmend gut gefallen hatte und den ich sehr gern weiterempfehle, las ich nun den bereits 1932 erstmals und nun im Februar 2020 in neuer Übersetzung erschienenen Krimi "Maigret in der Liberty Bar": Der Mord an einem Australier führt Kommissar Maigret an die Côte d’Azur, wo er sich im milden Mittelmeerklima wie im Urlaub fühlt. Erst nach dem Anblick des Toten, der ihm verblüffend ähnelt, beginnt sich Maigret für den Mann zu interessieren, der für den französischen Geheimdienst arbeitete, mit zwei Frauen zusammenlebte und Verbindungen in eine seltsame Bar hatte - die Liberty Bar. Auch in diesem Maigret-Krimi liegt der Schwerpunkt des Romans [wie angeblich bei den anderen Maigret-Romanen auch] weniger auf äußerer Handlung als auf dem inneren Prozess Maigrets, der zunächst einmal das Geschehen zu verstehen versucht. Nach einigem Hin und Her ist die Tat endlich aufgeklärt, doch am Ende gibt es keine Verhaftung, sondern Maigret überlässt die Täterin ihrem ohnehin schweren Schicksal. Ist "Maigret in der Liberty Bar" nun einer von Simenons schwächeren Krimis? Ich hatte mir nach meinem ersten Simenon-Roman (siehe oben) jedenfalls mehr vom berühmten „Maigret“ versprochen. Stellenweise langweilte mich der Krimi sogar. Liegt es vielleicht am Alter des Krimis, der immerhin vor fast 90 Jahren geschrieben wurde? Mag sein. Heutzutage verlangt man nach mehr Tempo, mehr Action, noch mehr Psycho – alles dies fehlte mir hier. Der Roman schien mir zudem nicht schlüssig, die Auflösung allzu überraschend. Nach diesen zwei Erfahrungen kann ich mir durchaus vorstellen, einen weiteren Non-Maigret-Roman von Georges Simenon zu lesen, einen weiteren "Maigret" aber wohl eher nicht. |
|
| Bewertung vom 13.04.2020 | ||
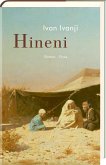
|
REZENSION – Es ist kein biblischer Text, und doch ist es eine Geschichte aus der Bibel: „Hineni“, der aktuelle Roman des serbischen Schriftstellers Ivan Ivanji (91), schildert – ohne biblischen Pathos, sondern eher augenzwinkernd geschrieben – die modern erzählte Lebensgeschichte Abrahams, der vor 4 000 Jahren auszog, um als „Vater vieler Völker“ im „gelobten Land“ Kanaan alle dort lebenden Stämme zu vereinen, ein eigenes Volk zu gründen und dem einen allmächtigen Gott zu dienen. „Hineni“ ist ein versöhnlicher Roman, geschrieben von einem Überlebenden der KZs Auschwitz und Buchenwald. Der 1929 in Serbien als „zufälliger Jude“ Geborene versteht sich noch heute, Jahrzehnte nach dem Zerfall Jugoslawiens, als Bürger des einst von General Tito zusammengehaltenen Vielvölkerstaates, dessen Dolmetscher Ivanji war. Dies zu wissen, hilft die Botschaft seines lesenswerten Romans zu verstehen. |
|
| Bewertung vom 11.04.2020 | ||

|
Felix und die Quelle des Lebens REZENSION – Ist es eine poetische Erzählung, eine zeitgenössische Fabel, ein modernes Märchen? Wie auch immer: „Felix und die Quelle des Lebens“, der achte Band seines 1997 begonnenen „Zyklus des Unsichtbaren“ des französischen Schriftstellers Eric-Emmanuel Schmitt (60), ist einfach schön zu lesen und macht dem Wortsinn der „Belletristik“ alle Ehre. Schmitt, der 2001 mit „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Korans“ seinen internationalen Durchbruch hatte, verzaubert wohl jeden Leser mit dieser anrührenden und lebensklugen, dabei recht locker und humorvoll geschriebenen Geschichte um den 12-jährigen Felix, der mit seiner aus Senegal stammenden Mutter Fatou in Paris lebt und ihr, die bislang mit ihrer Lebensfreude strahlender Mittelpunkt seines Lebens war, nun in verzweifelter Situation aus tiefster Schwermut hilft. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 10.04.2020 | ||

|
Pandora / Stein und Wuttke Bd.1 REZENSION – Als „historischer Thriller“ über die Nachkriegszeit in Berlin angekündigt, durfte man auf das Krimi-Debüt „Pandora. Auf den Trümmern von Berlin“ des in Berlin lebenden Autoren-Duos Liv Amber und Alexander Berg gespannt sein, bieten doch gerade die Nachkriegsjahre vielerlei Ansatzpunkte für einen interessanten Roman um „alte Schuld und neue Sünden“. Doch „Pandora“ ist leider weder historisch interessant noch als Kriminalroman spannend genug. Stattdessen ist die Handlung um den aus dem britischen Exil in seine von Ost-West-Spaltung und sowjetische Blockade gebeutelte Heimatstadt heimgekehrten Hans-Joachim Stein, Kriminalkommissar in der neuen Westberliner Mordinspektion, allzu durchsichtig. Schon nach 100 der knapp 450 Seiten ist der Zusammenhang zweier Mordfälle zu durchschauen. Schnell wird deutlich, dass es um die mangelhafte Aufarbeitung von Euthanasie- und anderer Verbrechen geht, die in den Nachkriegsjahren bekanntermaßen, da viele Nazis in West-Berlin und in der jungen Bundesrepublik wieder in Justiz und Verwaltung eingesetzt waren, von alten NS-Seilschaften gezielt behindert wurde. |
|