BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 51 Bewertungen| Bewertung vom 17.10.2023 | ||

|
Das Buch der Phobien und Manien Zu allererst einmal: Herzlichen Glückwunsch an den Verlag Klett-Cotta. Was für ein schönes Buch. Und zwar nicht nur von außen sondern auch von innen. Das kommt alles very, very British rüber. Und auch die Autorin, Kate Summerscale, ist ein durch und durch britisches Gewächs, mit kleinen Abstechern über den großen Teich. Für ihre zahlreichen Sachbücher hat sie bisher etliche Preise und Ehrungen erhalten. |
|
| Bewertung vom 13.10.2023 | ||

|
Menachem Kaiser hat ein Buch geschrieben. Und weil er ein junger Wilder ist, muss er auf gar keine Regel achten. Über den Autor, seinen Hintergrund und seine Motivationen erfährt man mehr aus einem Interview, das der österreichische Standard am 7. Oktober 23 veröffentlichte (https://kurier.at/kultur/buch/menachem-kaiser-ueber-die-obsession-mit-nazi-geheimnissen/402604277). |
|
| Bewertung vom 04.10.2023 | ||
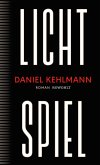
|
Nach gut fünf Jahren kommt Mitte Oktober ein neuer Titel von Daniel Kehlmann in den Handel. „Lichtspiel“ erscheint im Verlag Rowohlt. Einem großen Publikum wurde der Autor mit dem Roman „Die Vermessung der Welt“ im Jahr 2005 bekannt; in 2017 erschien „Tyll“, ein Buch, das von Kritik und Leserschaft gleichermaßen gemocht wurde. |
|
| Bewertung vom 11.09.2023 | ||

|
„Alles hin.“ Die Mutter, das Geld, das Leben. |
|
| Bewertung vom 13.08.2023 | ||

|
Die Akte Madrid / Lennard Lomberg Bd.2 Nach getaner Lektüre habe ich mich schwergetan, etwas zu diesem Buch zu schreiben, das die Leserin oder den Leser auch „informierter“ macht. Also habe ich den Computer befragt, ob er wohl noch meinen Text zum ersten Band der Reihe „Das neunte Gemälde“ aufbewahrt habe. Hatte er. |
|
| Bewertung vom 01.08.2023 | ||

|
„Manchmal ist das Beste, worauf man hoffen kann, ein kleiner Moment des Friedens und eine kleine Gnade“. |
|
| Bewertung vom 24.07.2023 | ||

|
Der Frühling ist in den Bäumen Von heute aus gesehen, ist das, was Jana Revedin auf den ersten Seiten ihres Buches beschreibt, ganz und gar unfasslich. Ein Ehemann vergewaltigt seine Frau. Aber nicht einfach mal „nur so“ sondern planmäßig, um seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Dazu lädt er auf einem Kongress ein befreundetes Paar ein, betäubt seine eigene Ehefrau, und es gibt einen Dreier plus der willenlosen Gattin, an der die anderen sich vergehen. |
|
| Bewertung vom 28.04.2023 | ||
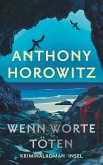
|
Wenn Worte töten / Hawthorne ermittelt Bd.3 „Seit Lucrezia Borgia bin ich die Frau, |
|
| Bewertung vom 09.04.2023 | ||

|
Sein „Schreibpate“ ist Maxim Biller. Was kann da schief gehen? |
|
| Bewertung vom 20.03.2023 | ||

|
Aus dem Pappumschlag fiel ein Buch – ein blaues Buch. Von außen und auch innen. Versprochen wird: Eine fesselnde Reise durch die griechische Mythologie. Für junge Menschen. Leider gibt es nirgends eine Altersangabe. Der Verlag sagt: Zum Vorlesen und Schmökern. Oh ha, ich weiß nicht, ob ich einem Kind, das selbst noch nicht lesen kann, die Geschichte vom kleinen Hermes vorlesen will, der eine Schildkröte tötet, um daraus seine erste Lyra zu bauen. Und das ist nicht die schlimmste Grausamkeit, die das „gewitzte Kerlchen“ im Portfolio hat. Aber, daran müssen wir uns eben gewöhnen, auf und um den Olymp ging es damals durchaus handfester zu als heute unsere verweichlichten Gemüter so gewohnt sind. |
|
