Insgesamt 584 Bewertungen
Zur vorherigen Seite 1 Zur Seite 1 2 Aktuelle Seite 3 Zur Seite 3 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten59Zur letzten Seite, Seite 59Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
Zur vorherigen Seite 1 Zur Seite 1 2 Aktuelle Seite 3 Zur Seite 3 4 Zur Seite 4...Weitere Seiten59Zur letzten Seite, Seite 59Zur nächsten SeiteZur letzten Seite




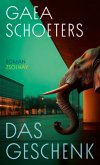

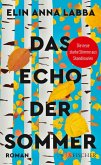
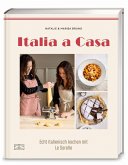
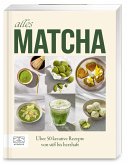

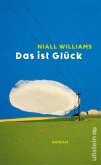

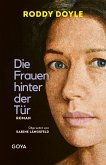
Benutzer