BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 20 Bewertungen| Bewertung vom 24.10.2023 | ||

|
Unendlicher Spaß (eBook, ePUB) Dieses Werk ist der Ironman der Literatur. Wer dieses Buch wirklich bis zur letzten Zeile durchgehalten hat, sollte vom Kiepenheuer & Witsch Verlag ein Finisher-T-Shirt zugeschickt bekommen. Mit 1551 Seiten oder 3.486 KB setzt David Foster Wallace alles daran, in Marcel Proust’s Fussstapfen zu treten. Die ganz persönliche Lesezeit betrug ein Jahr. War es eine verlorene Zeit? Machen wir uns auf die Suche. |
|
| Bewertung vom 23.06.2023 | ||

|
Christian Kracht ist Schweizer mit deutschen Wurzeln. Er sieht sich selbst als Kosmopolit. Nach eigener Aussage begreift er seine Romane eher „humoristisch“, löst mit seinem Werk und Leben allerdings häufig heftige Kontroversen aus. Ein Mensch und Autor, der nicht einzuordnen ist, und der in Eurotrash offensichtlich immer noch nach seinem eigenen Platz und Stellenwert in einem Leben sucht, dessen materielle Rahmenbedingungen andere bei einem flüchtigen Blick neidvoll als beste Vorraussetzungen für unbeschwertes Glück ansehen würden. |
|
| Bewertung vom 03.04.2023 | ||

|
Ein neuer von Schirach. Ab dem Erscheinungstag auf Platz 1 der Spiegelbestsellerliste. Ferdinand von Schirach ist derzeit der erfolgreichste und berühmteste Schriftsteller Deutschlands. Aber nicht nur das, seine Geschichten und Romane werden in über 40 Sprachen übersetzt und ganz viele für Leinwand und Fernseh-Serien verfilmt. |
|
| Bewertung vom 20.01.2023 | ||

|
Drei fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt Der schwedische Autor Jonas Jonasson gehört zu den Autoren, die aus jedem Buchtitel eine Kurzgeschichte machen. „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ war sein Erstlingswerk, das den Journalisten auf einen Schlag weltberühmt und reich machte, da es sich nicht nur millionenfach verkaufte, sondern auch in 45 Sprachen übersetzt und verfilmt wurde. |
|
| Bewertung vom 30.10.2022 | ||

|
Zuallererst: Nicht überall, wo Ian McEwan drauf steht, ist auch Ian McEwan drin. Wer als Leser also das übliche, flüssig-harmonische Gleiten einer bisweilen pointierten, aber immer eingängigen Handlung wie in „Honig“ oder „Solar“ erwartet, sei vorgewarnt. Surrealistische Trends wie in „Der Tagträumer“ haben bereits aufblitzen lassen, dass der Autor auch anders kann, wenn er will. |
|
| Bewertung vom 13.10.2022 | ||

|
Schrecklich amüsant - aber in Zukunft ohne mich Was bewirkt dieser ungewöhnlich lange Titel? Man hat keine Ahnung, um was es geht und wird zum einen automatisch neugierig, wovor hier denn so ambivalent gewarnt werden soll. Also Verlags-Marketing-Strategie? |
|
| Bewertung vom 13.09.2022 | ||

|
Gebrauchsanweisung für Thailand Mit der Reihe der „Gebrauchsanweisungen“ ist dem Piper-Verlag eine echte Erfolgsgeschichte gelungen. Nach der ersten „Gebrauchsanweisung für Amerika“ von Paul Watzlawick, die bereits 1978 auf den Markt kam, sind mittlerweile etwa 120 weitere Bände erschienen und jedes Jahr kommen sechs bis acht neue hinzu, in denen namhafte Autoren ihre Eindrücke und ortskundige Geschichten aufschreiben und sich mit persönlichem Blick den Ländern, Regionen oder Städten auf ungewöhnliche und literarische Weise annähern. |
|
| Bewertung vom 13.09.2022 | ||
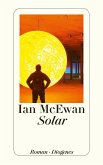
|
Nicht, dass ich ein Anhänger irgendwelcher Kategorisierungen wäre. Nein, im Gegenteil. Schon immer empfinde ich diese zwanghafte Penetranz der Verlage, jedem Buch einen Genre-Stempel aufzudrücken, eher als Ausdruck ihrer eigenen anachronistischen Rigidität. Aber bei Ian McEwans „Solar“ fragt man sich dann doch schon mal, was ist das eigentlich? |
|
| Bewertung vom 11.09.2022 | ||

|
Nett. Das ist das erste, was einem einfällt, wenn man die letzte Seite dieses Buches gelesen hat. Und schön kurz. An einem entspannten Nachmittag hat man die 145 Seiten print und 534 KB digital durch. |
|
| Bewertung vom 12.11.2021 | ||

|
Erfüllendes Mutterglück oder kinderlose Freiheit? (eBook, ePUB) Soviel vorneweg - auch wenn im Titel von „Mutterglück“ die Rede ist, so ist das Buch der deutschen Autorin Ellen Kuhn nicht nur an Frauen adressiert, sondern unbedingt auch etwas für Männer. Denn wie oft schlittern wir Männer in eine Familien- respektive Vater-Situation hinein, nur weil es Konvention und Tradition so vorgeben und/oder weil es für uns mal wieder einfach bequemer so ist. Dazu gehört sicher auch, dass viele Männer gerade die Kinderentscheidung nicht wirklich überdenken und sich der Tragweite für ihr eigenes Leben nicht bewusst sind. Das Scheitern ist statistisch fast schon vorprogrammiert. Selbst moderne Männer gründen heutzutage bei Misslingen des Ehe- und Kinderprojekts keine „I regret“-Gruppen, sondern wählen auch da den ganz traditionellen Weg, also Flucht, Trennung, Geliebte. Nur erfährt dieses männliche Verhalten im Gegensatz zu den Müttern bis heute keine auch nur ansatzweise ähnlich ausgeprägte Ächtung in unserer Gesellschaft. |
|
