BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 368 Bewertungen| Bewertung vom 02.02.2020 | ||

|
REZENSION - Den „eisernen Gustav“ glauben viele zu kennen. Doch der Rühmann-Film von 1958 hat mit Hans Falladas gleichnamigen Roman von 1938 nichts zu tun, schildert er doch nur die Kutschfahrt des wahren Berliner Droschkenkutschers Gustav Hartmann (1859-1938) im Jahr 1928 nach Paris. Fallada griff dieses damals öffentlichkeitswirksame Ereignis lediglich gegen Ende seines Romans um seinen fiktiven Kutscher Gustav Hackendahl auf. Doch auch wer Falladas „Der eiserne Gustav“ gelesen hat, hatte nie seinen Originaltext, der verschollen ist, sondern nur einen bearbeiteten Text in der Hand. Erst jetzt nach über 80 Jahren erschien im Aufbau-Verlag eine Ausgabe mit jenem Ende, „wie ihn der Verfasser gewollt hatte“, und in einer der Urfassung nahekommenden Fassung, wie es Fallada-Forscherin und Herausgeberin Jenny Williams in ihrem ausführlichen Nachwort nachweist. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 14.01.2020 | ||

|
REZENSION – In seinem im Oktober bei Ullstein veröffentlichten Roman „Federball“ widmet sich der britische Schriftsteller John le Carré (88) den aktuellen politischen Themen seines Landes - dem Brexit und der ersatzweise gesuchten Nähe zu den USA und deren Präsidenten Donald Trump. Dabei macht der Altmeister des britischen Spionageromans keinen Hehl aus seiner eigenen entschiedenen Ablehnung in beiden Punkten. Zugleich zeigt er aber in der Handlung und deren Protagonisten den für viele patriotisch gesinnte Briten entstandenen Konflikt, sich gegen das eigene Land stellen zu müssen. |
|
| Bewertung vom 10.01.2020 | ||

|
REZENSION – Es gibt nur wenige deutsche Schriftsteller unserer Zeit, die wie Hanns-Josef Ortheil gleichzeitig und mit dauerhaftem Erfolg in unterschiedlichsten literarischen Genres heimisch sind. Ob autobiografische oder historische Romane, ob Essays oder Sachliteratur, immer wieder versteht es der 68-jährige Autor aufs Neue, mit seinem aktuellen Buch die Bestsellerliste zu erobern. Gerade waren im Mai 2019 seine Kindheits- und Jugenderinnerungen „Wie ich Klavier spielen lernte“ erschienen, folgte nur ein halbes Jahr später die Romanbiografie „Der von den Löwen träumte“, eine liebevolle Hommage an den amerikanischen Nobelpreisträger Ernest Hemingway (1899-1961). 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 09.01.2020 | ||

|
REZENSION – Ein ereignisreiches, manchmal aufregendes, in jedem Fall aber interessantes Berufsleben schildert Heide Sommer (79) in ihren im Ullstein-Verlag veröffentlichten Erinnerungen „Lassen Sie mich mal machen“. Kaum ein anderer Titel als dieses fast schon klassische Zitat könnte das arbeitsreiche Leben als langjährige Redaktionssekretärin so bekannter Publizisten wie Rudolf Augstein, Joachim Fest, Günter Gaus und Theo Sommer oder als Privatsekretärin namhafter Schriftsteller wie Fritz J. Raddatz und Carl Zuckmayer oder Altpolitiker wie Loki und Helmut Schmidt sowie Klaus von Dohnanyi besser in einem Satz zusammenfassen. |
|
| Bewertung vom 07.01.2020 | ||

|
1794 / Winge und Cardell ermitteln Bd.2 REZENSION – War schon sein vielfach ausgezeichnetes und bisher in 30 Ländern erschienenes Thriller-Debüt „1793“ einer der besten historischen Romane vergangener Jahre, so hat der schwedische Autor Niklas Natt och Dag (40) mit dem Folgeroman „1794“ etwas geschafft, was kaum einem Bestsellerautor gelingt: Der zweite Roman, kürzlich im Piper-Verlag erschienen, ist noch besser gelungen! Erneut begleiten wir den kriegsversehrten Häscher Jean Michael Cardell und die als Gastwirtstochter „adoptierte“ Anna Stina Knapp durch das Jahr im alten Stockholm. Auch dieser Folgeband ist wieder in vier Teile mit jeweils wechselnden Hauptfiguren gegliedert. Ihre Lebenswege treffen sich zum Schluss und führen zu einem überraschenden, aber schlüssigen Ergebnis. Zwar baut der zweite Band historisch und atmosphärisch auf dem Erstlingswerk auf, doch ist es nicht zwingend notwendig, den Vorgängerband unbedingt gelesen zu haben. |
|
| Bewertung vom 13.12.2019 | ||

|
Inspektor Takeda und das doppelte Spiel / Inspektor Takeda Bd.4 REZENSION – Waren die ersten drei Romane um den japanischen Austausch-Inspektor Kenjiro Takeda, dem „ungewöhnlichsten Helden der deutschen Krimi-Szene“ vergleichsweise harmlose, aber sehr vergnügliche Krimis, wenn man allein an die japanischen Teestunden im Hamburger Morddezernat denkt, fällt doch der vierte, im August veröffentlichte Band „Inspektor Takeda und das doppelte Spiel“ völlig überraschend aus dem gewohnten Rahmen. Was Autor Henrik Siebold, Pseudonym für den in Hamburg lebenden Journalisten und Schriftsteller Daniel Bielenstein (59), diesmal abgeliefert hat, ist ein erstaunlichen Politthriller. Trafen in den ersten Bänden in den Charakteren Ken Takedas und seiner Kollegin Claudia Harms lediglich unterschiedliche Mentalitäten und Kulturen aufeinander, prallen in diesem vierten Band geradezu unterschiedliche Welten aufeinander. Zudem behandelt der Autor historische und aktuelle gesellschaftspolitische Probleme beider Länder und zeigt am Beispiel des Neonazismus mögliche Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. |
|
| Bewertung vom 08.12.2019 | ||

|
REZENSION – Eigentlich hatte der schwedische Schriftsteller Håkan Nesser (69) seinen Ex-Kommissar Van Veeteren, die „lebende Legende der Maasdamer Kriminalpolizei“, schon vor 16 Jahren im zehnten Band dieser Krimireihe, „Sein letzter Fall“ (2003), endgültig den verdienten Ruhestand genießen lassen wollen. Doch die in über 20 Sprachen übersetzte Erfolgsreihe – oder war es Nessers Verlag? - verlangte wohl eine Fortsetzung. So sieht sich also Van Veeteren kurz vor seinem gefürchteten 75. Geburtstag im kürzlich auf Deutsch erschienenen Roman „Der Verein der Linkshänder“ doch gezwungen, einen 20 Jahre zurückliegenden Mordfall erneut aufzurollen. |
|
| Bewertung vom 23.11.2019 | ||

|
Totenland / Inspektor Jens Druwe Bd.1 REZENSION – Beherrschten bislang eher die Vorkriegs- und Nachkriegsjahre das Genre aktueller historischer Romane, schlägt jener norddeutsche Arzt und Buchautor, der kürzlich sein Krimi-Debüt unter dem Pseudonym Michael Jensen im Aufbau-Verlag veröffentlichte, ein neues und literarisch weit schwierigeres Kapitel deutscher Zeitgeschichte auf: Sein lesenswerter Roman „Totenland“ spielt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs – also in der Zeit des Zusammenbruchs, als das Dritte Reich eigentlich schon untergegangen war, Hitler im Führerbunker Selbstmord beging, führende Nazi-Funktionäre sich vor den alliierten Siegermächten in Sicherheit brachten, Flüchtlinge aus dem Osten in Westdeutschland Zuflucht suchten, die dort in zerbombten Städten hilflos zurückgelassene Bevölkerung notdürftig zu überleben versuchte, viele Menschen aber in ihrer Verzweiflung den Freitod wählten. In diesen wirren Tagen des Untergangs beginnt Michael Jensens Krimi „von Opfern und Tätern“ mit einem „Mord in Deutschlands Stunde Null“. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 16.11.2019 | ||

|
Lacroix und die Toten vom Pont Neuf / Kommissar Lacroix Bd.1 REZENSION – „Maigret, Telefon für Sie.“ Gleich der erste Satz in dem kürzlich im Kampa-Verlag veröffentlichten Roman „Lacroix und die Toten vom Pont Neuf“, dem Krimidebüt eines geheimnisvollen, unter dem Pseudonym Alex Lépic schreibenden deutschen Schriftstellers (39), zeigt uns, womit wir es zu tun haben: Der augenzwinkernde Krimi ist eine Verbeugung vor Georges Simenon (1903-1989) und dessen Figur Kommissar Maigret. Held des aktuellen Romans ist Commissaire Lacroix, der „beste Kommissar von Paris“, doch in seinen altmodischen Marotten und seinem Äußeren dem literarischen Vorgänger zum Verwechseln ähnlich. Kein Wunder also, dass die Lehrerin einer Schulklasse vor dem ebenfalls im Kommissariat untergebrachten Polizeimuseum im fünften Arrondissement am linken Seineufer diesen Kommissar in Hut und Mantel und Pfeife im Mund anstarrt, als er mit seinem Mitarbeiter Paganelli das Gebäude verlässt. Paganelli, schlagfertig wie so oft, nutzt ihr Staunen: „Schauen Sie ruhig hin, das ist er. Direkt aus dem Museum: unser Commissaire Maigret. Wir müssen ihn uns kurz für eine Ermittlung ausleihen. Aber keine Sorge, wir bringen das wichtigste Exponat nachher wieder zurück.“ Jetzt wissen wir es: Lacroix ist der neue Maigret! 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 02.11.2019 | ||
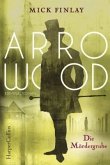
|
Die Mördergrube / Arrowood Bd.2 REZENSION – Mit „Arrowood – Die Mördergrube“ erschien kürzlich der zweite Band in der Reihe historischer Krimis des britischen Schriftstellers Mick Finley. Wieder begleiten wir im viktorianischen London des Jahres 1896 seinen Protagonisten William Arrowood, den leider nur zweitbesten Privatdetektiv nach Sherlock Holmes, und seinen Assistenten Norman Barnett „In den Gassen von London“ (2018), wie schon der erste Band hieß, bei der Aufklärung eines überaus mysteriösen Kriminalfalles. |
|