BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 368 Bewertungen| Bewertung vom 16.06.2019 | ||

|
Ein perfider Plan / Hawthorne ermittelt Bd.1 REZENSION – Eine ungewöhnliche und intelligente Detektivgeschichte mit typisch britischem Humor und ironischen Spitzen gegen die Welt der Film- und Literaturschaffenden, dabei völlig unblutig, nach klassischem Muster erzählt, aber in unserer Zeit spielend, hat uns Englands Bestseller-Autor Anthony Horowitz (64) mit seinem neuen Roman „Ein perfider Plan – Hawthorne ermittelt“ beschert. Dazu muss man wissen, dass Horowitz als einer der produktivsten und erfolgreichsten Schriftsteller Großbritanniens vor Jahren von den Erben Conan Doyles offiziell beauftragt wurde, neue Geschichten um Sherlock Holmes zu schreiben (2011: „Das Geheimnis des weißen Bandes“; 2014: „Der Fall Moriarty“). Eine moderne Holmes-Watson-Variante ist nun dieser erste Band seiner neuen Reihe „Hawthorne ermittelt“. |
|
| Bewertung vom 10.06.2019 | ||

|
Das Spannende an Debütromanen ist das Unerwartete, der Überraschungseffekt, weshalb man als Leser unbekannten Autoren immer eine Chance geben sollte. Eine solche literarische Überraschung ist zweifellos „Dschungel“, der erste Roman des Journalisten und Sachbuch-Autors Friedemann Karig (37). Es ist die in erfrischender Sprache lebensecht wirkende Geschichte einer echten Männerfreundschaft – die Geschichte zweier Kindheits- und Jugendfreunde, die völlig gegensätzlich im Charakter nur gemeinsam ein Ganzes bilden und deshalb ohne den anderen nicht auskommen können. |
|
| Bewertung vom 28.05.2019 | ||
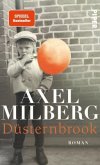
|
REZENSION - Fehlen in der Autobiographie bekannter Schauspieler jene zur voyeuristischen Befriedigung ihrer Leser nötigen Höhepunkte, muss entweder der Verlag sein Marketing verstärken oder der Autor seinen Erinnerungen noch Fiktives hinzufügen. Beides scheint beim literarischen Debüt des vor allem als Kieler Tatort-Kommissar Borowski beliebten Axel Milberg (62) der Fall zu sein: In „Düsternbrook“ schildert der Schauspieler auf 290 Seiten seine Kinder- und Jugendjahre im gleichnamigen Kieler Villenviertel. |
|
| Bewertung vom 24.05.2019 | ||

|
Zara und Zoë - Rache in Marseille / Die Profilerin und die Patin Bd.1 REZENSION - Nicht nur beruflich als Polit-Korrespondent beim Fernsehen und vormaliger Leiter eines Korrespondentenbüros in Paris, sondern auch durch seine häufigen Privataufenthalte in Frankreich ist Krimi-Autor Alexander Oetker (37) gewiss ein Kenner des französischen Politik- und Gesellschaftsystems, über dessen Probleme wir in Deutschland gerade in den vergangenen Jahren aufgrund dortiger Terroranschläge und Gelbwesten-Krawalle viel erfahren haben. Nach seinen ersten, seichteren Krimis um den Feinschmecker und Commissaire Luc Verlain wechselte Oetker mit seinem im April als Droemer-Taschenbuch veröffentlichten Thriller „Zara & Zoë. Rache in Marseille“, dem ersten Band einer unter dem Titel „Die Profilerin und die Patin“ angekündigten Reihe, von der früher eher touristisch-freundlichen Seite nun unerwartet auf die politisch-brutale, wie sie uns die Abendnachrichten mit Meldungen über IS-Terror und die von Polizei und Politik scheinbar unbeherrschbaren Probleme in den Außenbezirken (Banlieues) der französischen Metropolen zeigen. Sogar Oetkers neue Protagonistin, die deutsche Europol-Kommissarin Zara von Hardenberg traut sich in ihrem ersten Fall nur mit einer Spezialeinheit in ein solches Stadtviertel, obwohl sie selbst einst dort aufgewachsen ist. |
|
| Bewertung vom 11.05.2019 | ||

|
Wer sich traut, auch Bücher unbekannter Autoren zu lesen, wird nicht selten mit literarischen Bestleistungen belohnt. Dies gilt auch für den kürzlich im Wagenbach-Verlag veröffentlichten Debütroman „Ich kann dich hören“ der erst 28-jährigen Katharina Mevissen. Schon vor drei Jahren wurde ihr Manuskript völlig zu Recht mit dem Bremer Autorenstipendium belohnt. Im Buch geht es um die vielen Menschen fehlende Fähigkeit, sich mit anderen auszusprechen, mit anderen zu verständigen, anderen zuzuhören. Es geht ums Sprechen und Hören, auch um Gebärdensprache und Musik als Mittel des Ausdrucks, um verbale und nonverbale Verständigung. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 27.04.2019 | ||

|
REZENSION – Bücher über die Jahre des Nazi-Regimes, über Judenverfolgung, den Holocaust und die deutsche Schuld gibt es zuhauf. Doch Maxim Leo (49) hat es mit der Niederschrift seiner bis in letzte Feinheiten recherchierten Familiengeschichte „Wo wir zuhause sind“ [im Februar bei Kiepenheuer & Witsch erschienen] auf ungewöhnlich berührende Weise geschafft, den Begriff „Vergangenheitsbewältigung“ aus einer ganz anderen Warte zu beschreiben. Denn nicht nur die Täter hatten Jahrzehnte lang ihre Schwierigkeit damit. Auch viele Opfer, sofern sie die Schreckensherrschaft überlebten, hatten aus seelischen Eigenschutz diesen Lebensabschnitt im Herzen verschlossen und schwiegen. Im neuen Leben, das sie sich irgendwo in der Welt oder in Deutschland aufbauen mussten, wollte man keine Störung durch Erinnerungen. Dies ging Jahre lang gut, bis dann die Enkel begannen, sich für die ungewöhnliche Geschichte ihrer Eltern und Großeltern zu interessieren, bis die heutige Generation endlich begann, nachzufragen und nachzuforschen. 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 19.04.2019 | ||

|
REZENSION - Es ist ein sehr leiser, ein fast stiller Roman des serbischen Schriftstellers Ivan Ivanji (90), der kürzlich unter dem Titel „Tod in Monte Carlo“ im österreichischen Picus-Verlag erschien. Wir begleiten 1939/1940 den serbischen Arzt Moritz Karpaty im neutralen Fürstentum Monaco in dessen Einsamkeit, in seinen Selbstgesprächen und auf seiner Suche nach dem Ort absoluter Stille, einer Camera silens, wie der humanistisch gebildete Jude aus dem damals noch jugoslawischen Banat es selbst nennt. Hitlers Krieg tobte bereits, aber Jugoslawien war neutral. „Ich bin ja Jugoslawe, habe einen gültigen jugoslawischen Reisepass, fühle mich nicht in erster Linie als Jude, das Judentum hat mich nie besonders interessiert“, schreibt Karpaty, der einst seinen Familiennamen Kohn hatte ändern lassen, in sein Tagebuch. |
|
| Bewertung vom 07.04.2019 | ||

|
1793 / Winge und Cardell ermitteln Bd.1 Ein in jeder Hinsicht „gewaltiges“ und eindrucksvolles Debüt ist dem schwedischen Journalisten Niklas Natt och Dag (40) mit seinem historischen Kriminalroman „1793“ gelungen, der jetzt im Piper-Verlag erschien und sowohl Freunde skandinavischer Krimis wie auch historischer Romane gleichermaßen begeistern wird. Völlig zu Recht wurde der schon 2017 in Schweden veröffentlichte, mittlerweile in 30 Sprachen übersetzte Bestseller mit dem Schwedischen Krimipreis ausgezeichnet. „1793“ ist ein historischer Roman, in dem der spannende Kriminalfall eher Mittel zum Zweck ist, um die vor 225 Jahren in Stockholm herrschenden Lebensbedingungen sowie politischen Ver- und Entwicklungen am Beispiel weniger Figuren abbilden zu können. „1793“ ist zudem ein sprachliches Meisterwerk, für dessen Übertragung ins Deutsche der Übersetzerin Leena Flegler (43) zu danken ist. Mit der starken Bildgewalt seiner Worte gelingt es dem Autor, aus aktionsreichen Szenen ein überaus plastisches Sittengemälde entstehen zu lassen, dass in seiner Gewalt und Brutalität einem manches Mal den Atem nimmt. |
|
| Bewertung vom 24.03.2019 | ||

|
REZENSION – Wer beim Titel „Die Leben danach“ eine theologisch-philosophische Antwort auf die Frage erwartet, was uns nach dem Tod wohl erwarten mag, liegt bei dem Roman des amerikanischen Schriftstellers Thomas Pierce (36) zwar nicht völlig daneben, doch braucht man schon eine gehörige Portion Humor. Sein Roman ist eher ein liebevolles „Mutmacher-Buch“. Pierce spielt mit verschiedenen Theorien, die ihn und seinen Protagonisten schließlich zur Einsicht bringen, lieber das jetzige Leben bewusst zu leben als erfolglos „die Leben danach“ erforschen zu wollen. Denn schneller als erwartet, könnten das Leben vorbei und dessen schöne Momente verpasst sein. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 10.03.2019 | ||

|
Die Farben des Feuers / Die Kinder der Katastrophe Bd.2 Spannend wie ein Krimi, sozialkritisch und amüsant wie ein guter Gesellschaftsroman, zugleich historisch interessant wie ein Sachbuch ist der kürzlich bei Klett-Cotta erschienene Roman „Die Farben des Feuers“ des französischen Bestseller-Autors Pierre Lemaitre (68). In gewisser Weise ist das Buch eine Fortsetzung seines 2013 veröffentlichten und mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Werks „Wir sehen uns dort oben“. Wieder geht es um die Bankiersfamilie Péricourt, diesmal aber nicht um Édouard, den Sohn des Bankengründers Marcel Péricourt, sondern um seine Schwester Madeleine. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|