BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 368 Bewertungen| Bewertung vom 11.01.2019 | ||

|
Der Turm der blauen Pferde / Kunstdetektei von Schleewitz Bd.1 Im gleichnamigen Buch des mit dem Friedrich-Glauser- und dem Deutschen Krimipreis ausgezeichneten Kriminalschriftstellers Bernhard Jaumann (61) geht es natürlich um das weltbekannte Gemälde „Der Turm der blauen Pferde“ des Expressionisten Franz Marc (1880-1916), das seit 1945 verschollen und wohl für immer verloren ist. Eingebettet in eine locker geschriebene Handlung um den möglichen Verbleib dieses Kunstwerks, aufbauend auf historischen Fakten, ist Jaumanns Krimi zugleich eine kritische, zumindest augenzwinkernde Auseinandersetzung mit der Kunst im Allgemeinen und deren kommerzieller Vermarktung, die – so verstehe ich das im Januar beim Berliner Verlag Galiani veröffentlichte Taschenbuch – in ungerechtfertigter Weise zu überzogenen Spitzenpreisen einzelner Meisterwerke führt. |
|
| Bewertung vom 08.01.2019 | ||
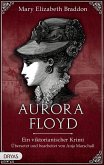
|
Die norddeutsche Publizistin und Journalistin Anja Marschall (52) schreibt zwar selbst seit einigen Jahren historische Kriminalromane, doch diesmal geht es nicht um sie als Autorin, sondern als Übersetzerin. Marschall nennt sich selbst eine „bekennenden Anglophile“ mit Begeisterung für das 19. Jahrhundert und widmet sich seit Jahren dem Leben der englischen Schriftstellerin Elizabeth Maria Braddon (1837-1915) und deren viktorianischen Krimis. Braddon war eine der populärsten Schriftstellerinnen des viktorianischen England und gilt als „Erfinderin des Ermittlerkrimis“, einst hochgelobt von Kollegen wie Charles Dickens und Thomas Hardy. Sie schrieb über 80 Romane, in denen sie unerschrocken damals heikle Themen wie Bigamie, Ehebruch oder Abtreibung in ihre Romane aufnahm. Nach Anja Marschalls 2013 veröffentlichter Neuübersetzung des Braddon-Krimis „Das Geheimnis der Lady Audley“ von 1862, der vor 150 Jahren ein einziges Mal auf Deutsch übersetzt wurde, erschien im November im Frankfurter Dryas-Verlag ihre zweite Übersetzung, der Krimi „Aurora Floyd“ (1863), den es anscheinend zuvor noch nie auf Deutsch gab. |
|
| Bewertung vom 06.01.2019 | ||
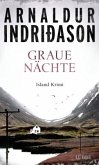
|
Graue Nächte / Flovent & Thorson Bd.2 Auf der aktuellen Welle historischer Kriminalromane aus jüngerer Geschichte schwimmt inzwischen auch Arnaldur Indriðason (57) recht erfolgreich mit, der durch seine frühere Krimireihe um Kommissar Erlendur zu Islands führendem Bestseller-Autor wurde. Nach dem ersten Band „Der Reisende“ um den isländischen Kommissar Flóvent und seinen Kollegen, den kanadisch-amerikanischen Militärpolizisten Thorsen, die gemeinsam mörderische Kriminalfälle auf der Insel zur Besatzungszeit während des Zweiten Weltkriegs aufzuklären haben, erschien nun im Dezember mit „Graue Nächte“ der zweite Band dieser neuen Krimireihe. |
|
| Bewertung vom 05.01.2019 | ||

|
Marlow / Kommissar Gereon Rath Bd.7 Einen Höhepunkt der chronologisch geordneten Reihe um Kommissar Gereon Rath und dessen Ehefrau Charly ist zweifellos „Marlow“, der siebte Band der im Berlin der Dreißiger Jahre angesiedelten und spätestens seit der TV-Serie „Babylon Berlin“ fast schon zum Kult gewordenen, in viele Sprachen übersetzten Krimi-Serie von Volker Kutscher. War der erste Band „Der nasse Fisch“ (2007) noch ein schlichter Kriminalroman vor historischer Kulisse, trat in den nachfolgenden Bänden allmählich die historische Szenerie, die Regierungsübernahme durch die Nazis, immer stärker hervor. Stand in Zeiten der Republik noch der Mensch im Vordergrund der Romane Kutschers ist es in Zeiten der Diktatur das Regime und dessen Methoden, unter dem die Menschen zu leiden und ihr Handeln abzuleiten haben. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 04.01.2019 | ||

|
Ein aus mehreren Gründen bemerkenswertes Buch ist dem deutschen Autor Christian Torkler (47) mit seinem Debütroman „Der Platz an der Sonne“ gelungen. Mit dem Flüchtlings- und Migrationsproblem greift er zwar ein nicht mehr neues, vor allem in Deutschland viel diskutiertes und von Journalisten abgearbeitetes Thema auf. Doch gelingt es ihm mit seinem überraschenden Ansatz, die Problematik aus völlig neuer Sichtweise zu betrachten: Bei ihm zieht es nicht die politisch verfolgten und unter schwierigsten Wirtschaftsverhältnissen lebenden Einwohner Afrikas in das aus ihrer Sicht paradiesische Europa. Torkler dreht den Spieß einfach um und erschafft in seinem Roman die total „verkehrte“ Situation eines nach dem dritten Weltkrieg endgültig zerstörten, in mehrere Länder aufgeteilten Deutschlands und eines im üppigen Wohlstand lebenden Afrikas. Jetzt sind es die Deutschen, die auf dem schwarzafrikanischen Kontinent ihren „Platz an der Sonne“ suchen. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 16.12.2018 | ||

|
William Shakespeare (1564-1616) und seine Theatertruppe im London des Jahres 1595. Als langjähriger Theaterfreund reizte mich gerade dieses Thema, zum ersten Mal einen historischen Roman des britischen Bestseller-Schriftstellers Bernard Cornwell (74) zu lesen. Cornwell wird dank der Vielzahl seiner in über 20 Sprachen übersetzten und mit mehr als 20 Millionen Exemplaren verkauften Romane als „unangefochtener König des historischen Abenteuerromans“ gepriesen. Doch sein neuestes Werk „Narren und Sterbliche“ (2017), im Juli im Wunderlich-Verlag auf Deutsch erschienen, war für mich mehr als enttäuschend. Es ist nur ein allzu seichter Unterhaltungsroman, der sich allenfalls als Vorlage für einen zweitrangigen Kostüm- oder Mantel-und-Degen-Film eignen könnte, in dem Schauspieler Schauspieler spielen, die in einem Schauspiel ein Schauspiel spielen. 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 08.12.2018 | ||

|
Vor zwei Jahren war dem Schriftsteller Gerhard Jäger mit seinem beeindruckenden Debütroman „Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod“ ein erstaunlicher literarischer Erfolg gelungen. Den Erfolg seines zweiten, im August beim Picus-Verlag veröffentlichten Kurzromans „All die Nacht über uns“ mitzuerleben, der durchaus verdient auf die Shortlist des Österreichischen Buchpreises kam, blieb ihm schon versagt: Der Österreicher starb am 20. November im Alter von nur 52 Jahren. |
|
| Bewertung vom 29.11.2018 | ||

|
Ein aus mehreren Gründen ungewöhnlicher Roman ist „Die Mittelmeerreise“ von Hanns-Josef Ortheil (67), im November beim Luchterhand-Verlag erschienen. Nach seiner „Moselreise“ (2010) und der „Berlinreise“ (2014) ist dies die Schilderung einer weiteren Urlaubsreise des Knaben Ortheil mit seinem Vater. Ungewöhnlich ist dieser detaillierte Reisebericht schon wegen seiner Mischung aus längeren Prosatexten des erst 15-jährigen Ortheil mit originalen Tagebucheinträgen und kurzen Essays, ergänzt durch einige zum jeweiligen Thema passende Reisenotizen des bald 60-jährigen Vaters. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 18.11.2018 | ||
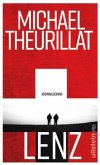
|
Lenz / Kommissar Eschenbach Bd.6 In welches Genre gehört eigentlich „Lenz“, der neue Roman des Schweizer Schriftstellers Michael Theurillat (57)? Ist es ein Krimi, wie der Ullstein-Verlag den im Oktober veröffentlichten sechsten Band aus der Reihe um den Züricher Kommissar Eschenbach nennt? Oder ist „Lenz“ eher ein Agenten- und Geheimdienst-Roman? Oder vielleicht sogar ein geopolitischer Politkrimi mit tagesaktuellem Bezug? „Lenz“ lässt sich in keine dieser Schubladen packen. Gerade dies macht den Roman so interessant und lesenswert. |
|
| Bewertung vom 16.11.2018 | ||

|
Eine beeindruckende, stellenweise auch berührende, in jedem Fall lesenswerte Romanbiografie ist „Das hungrige Krokodil“ von Sandra Brökel (46), die im Februar im Pendragon-Verlag erschien. In ihrem Debütroman schildert uns die gelernte Schreib- und Trauertherapeutin die wahre Lebensgeschichte des tschechischen Arztes Pavel Vodák (1920-2002), die ein Beispiel für das Schicksal vieler Tschechen ist. |
|