BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 501 Bewertungen| Bewertung vom 24.03.2021 | ||
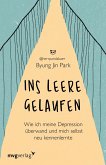
|
„Ich, depressiv? Niemals!“ – so dachte Byung Jin Park noch vor einigen Jahren. Schlafstörungen, Antriebslosigkeit, kurzer Geduldsfaden – ja, aber das liegt ja an etwas anderem. Dass er im zwei-Wochen-Rhythmus krank wurde hatte auch einen anderen Grund. Welchen? Das wusste er auch nicht so genau. Aber irgendwann konnte er sich vor der Diagnose nicht mehr verstecken. Der Anwalt musste sich der Wahrheit stellen: er leidet unter einer Depression. Wie er es geschafft hat, damit leben zu lernen, beschreibt der inzwischen 36-Jährige in seinem Buch „Ins Leere gelaufen“. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 23.03.2021 | ||
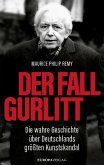
|
„Der Fall Gurlitt. Die wahre Geschichte über Deutschlands größten Kunstskandal“ von Maurice Philip Remy ist ein Buch, das mich in mehrerlei Hinsicht fassungslos zurückgelassen hat. Es ist für mich nicht nur ein Buch über einen „Kunstskandal“, sondern ein Buch über viel mannigfaltigere Skandale. Denn es umfasst neben dem „Skandal“ der gefundenen Kunstwerke auch skandalös unsaubere Ermittlungsarbeit von Polizei und Zoll, skandalös unseriöse Politiker und skandalös unethische Pressearbeit. Der Autor entwirrt auf über 400 Seiten (plus mehr als 100 Seiten Quellenangaben) minutiös die Fäden, die bei Cornelius Gurlitt 2013 zusammengelaufen sind, in dem Jahr, als der Focus „Der Nazi-Schatz“ titelte und herausposaunte, dass in Gurlitts Münchner Wohnung 1500 Beutekunst-Stücke gefunden worden wären. Heute würde man das „Fake News“ nennen. |
|
| Bewertung vom 23.03.2021 | ||

|
Guter Einblick |
|
| Bewertung vom 23.03.2021 | ||
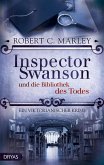
|
Inspector Swanson und die Bibliothek des Todes „Inspector Swanson und die Bibliothek des Todes“ von Robert C. Marley ist ein Buch, das mich sehr zwiegespalten zurücklässt. Einerseits hat der Autor die Atmosphäre der ehrwürdigen Bodleian Library (Bibliothek der Universitäten von Oxford) sehr gut eingefangen, das Viktorianische England des Jahres 1895 ist auch greifbar gut beschrieben, ich bin ein großer Fan von Oscar Wilde (um den sollte es schließlich auch gehen) und dennoch konnte mich das Buch als Krimi nicht begeistern. |
|
| Bewertung vom 16.03.2021 | ||
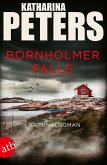
|
Bornholmer Falle / Sarah Pirohl ermittelt Bd.2 Innerhalb von nur vier Wochen hat Katharina Peters mit „Bornholmer Falle“ schon den zweiten Krimi dieses Jahres veröffentlicht. Respekt! Leidet die Qualität mit der Geschwindigkeit, in der sie „liefert“? Mitnichten! Auch Bornholmer Falle war für mich ein spannender und gut geschriebener Thriller. Zwar brauchte die Geschichte für mich ein wenig Zeit, um in Fahrt zu kommen, dann packte sie mich aber und der Schluss, ein mega Cliffhanger, ließ die Spannung fast ins Unermessliche steigen. Jetzt heißt es auf den nächsten Teil der Reihe warten. |
|
| Bewertung vom 02.03.2021 | ||
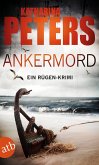
|
Ankermord / Romy Beccare Bd.10 (eBook, ePUB) Zwei Arbeiter entdecken an der Binzer Seebrücke eher zufällig eine männliche Leiche, die mit einer Ankerkette an einem Pfeiler unter Wasser angekettet wurde. Hauptkommissarin Romy Beccare steht vor einem Rätsel. Erst als die Identität des Toten geklärt ist, kommt sie einen kleinen Schritt weiter, die Ermittlungen erweisen sich aber als vielschichtig und enorm aufwändig. Denn Marek Liberth ist selbst kein unbeschriebenes Blatt, er ist wegen kleinerer Drogendelikte vorbestraft und von seinem letzten Arbeitgeber, einer Zuliefererfirma für Werften, entlassen worden. Auch zu seiner Kindheit im Heim könnte eine Spur auf der Suche nach dem Mörder führen. Haupt-Augenmerk der Ermittler liegt allerdings auf der Firma, bei der Liberth gearbeitet hat, denn auch die Chefin scheint einiges zu verbergen. |
|
| Bewertung vom 01.03.2021 | ||
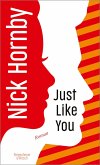
|
Über 20 Jahre nach „About a boy“ war es für mich mal wieder an der Zeit für ein Buch von Nick Hornby. Und da ich die Brexit-Verhandlungen gespannt verfolgt habe, fand ich sein neuestes Werk „Just like you“ interessant, verspricht es doch laut Klappentext „Liebe in Zeiten des Brexit“. Und tatsächlich schafft das Buch es auf sehr spannende Weise, beides zu verknüpfen. Und eines ist schon von Anfang an klar: kompliziert wird beides. |
|
| Bewertung vom 01.03.2021 | ||
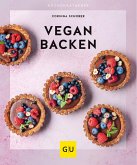
|
Zuerst einmal vorneweg: ich lebe weder vegetarisch noch vegan, sondern bestenfalls flexitarisch. Aber ich habe zweierlei: selten Eier im Haus und einen Mann, der gerne Kuchen isst. Also habe ich ein großes Faible für Backen ohne Eier entwickelt, und da bin ich mit veganen Rezepten immer sehr gut bedient. „Vegan Backen“ von Corinna Schober bietet für jeden, der ohne tierische Produkte backen möchte, ob Veganer oder nicht, ganz tolle Rezepte, Anregungen und Tipps. |
|
| Bewertung vom 01.03.2021 | ||
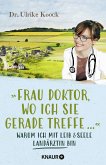
|
»Frau Doktor, wo ich Sie gerade treffe...« Dr. Ulrike Koock „kenne“ ich als Schwesterfraudoktor aus den sozialen Medien, wie man sich aus den sozialen Medien halt so „kennt“. Aber ich habe mich sehr auf und über ihr Buch „Frau Doktor, |
|
| Bewertung vom 23.02.2021 | ||
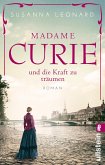
|
Madame Curie und die Kraft zu träumen / Ikonen ihrer Zeit Bd.1 Der Name Marie Curie ist sicher fast jedem geläufig, auch wenn man sich weder in Physik noch in Chemie übermäßig gut auskennt. Wer sich aber genauer hinter dem Namen verbirgt und welche Geschichte mit dem Namen verknüpft ist, wissen vermutlich nur wenige. Diese Wissenslücke will Susanna Leonard mit dem biografischen Roman „Madame Curie und die Kraft zu träumen“ füllen. Und das gelingt ihr meiner Meinung nach ganz hervorragend. |
|
