BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 368 Bewertungen| Bewertung vom 03.09.2018 | ||

|
Was kann eine Geschichte mit dem für heutige Zeit ungewöhnlichen Titel „Königskinder“ anderes sein als ein Märchen? Tatsächlich mutet dieser im August beim Hanser-Verlag erschienene und unbedingt lesenswerte Kurzroman des Schweizer Schriftstellers Alex Capus (57) wie eine der vielen Geschichten aus „Tausendundeine Nacht“ an, wenn auch in moderner Erzählweise. |
|
| Bewertung vom 02.09.2018 | ||

|
In den Gassen von London / Arrowood Bd.1 Historische Kriminalromane liegen im Trend. So überrascht es nicht, dass auch der schottische Autor Mick Finlay sein Krimidebüt „Arrowood – In den Gassen von London“, auf Deutsch im August beim Verlag Harper Collins als Taschenbuch erschienen, ins Jahr 1895 verlegt. Doch Finlay hat eine nette literarische Überraschung: Seine Hauptfigur, der Privatermittler William Arrowood ist gewissermaßen der „Antiheld“ einer Epoche, in der ganz London vom berühmten Meisterdetektiv Sherlock Holmes begeistert ist, jener von Arthur Canon Doyle geschaffenen Kunstfigur. |
|
| Bewertung vom 26.08.2018 | ||

|
Was bin ich? Wie bin ich? Wozu bin ich? "Wer bin ich – und wenn ja, wie viele“ betitelte vor gut zehn Jahren der Philosoph und Autor Richard David Precht seinen damaligen Bestseller. Genau dieser Frage, die Philosophen von jeher und uns Normalbürger spätestens seit der Aufklärung immer wieder beschäftigt, geht auch der Augsburger Psychologe und Führungskräfte-Coach Hermann Rühle (74) in seinem Buch „Was bin ich? Wie bin ich? Wozu bin ich?“ nach, das Mitte August bei dielus edition erschien, einem jungen Leipziger Verlag für Ratgeberliteratur. Nach der Lektüre dieses 240 Seiten starken Buches sollte eine Antwort auf die Frage gefunden sein: „Bin ich, wer ich bin?“ 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 23.08.2018 | ||

|
Eine solche Familiengeschichte kann sich ein Autor fiktiver Romane kaum ausdenken; das muss man einfach erlebt haben: Auf eine Zeitspanne von hundert Jahren oder drei Generationen blickt der niederländische, 1944 noch in Posen geborene Journalist und Autor Alexander Münninghoff (74) in seiner Autobiografie „Der Stammhalter“ zurück, deren holländisches Original (2015) zweifach prämiert wurde, in den Niederlanden gerade als zehnteilige TV-Serie verfilmt wird und im Juli beim C.H. Beck-Verlag in deutscher Übersetzung erschien. Es ist eine abenteuerliche Familiensaga über den teils historisch bedingten, größtenteils aber selbst verschuldeten Niedergang seiner einst wohlhabenden Industriellenfamilie. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 16.08.2018 | ||

|
Das Verschwinden des Josef Mengele „Nur mit der Form des Romans konnte ich dem makabren Leben des Nazi-Arztes möglichst nahekommen“, schreibt der französische Journalist und Schriftsteller Olivier Guez (44) im Quellennachweis seines 2017 in Frankreich mit dem Prix Renaudot prämierten Romans „Das Verschwinden des Josef Mengele“, der jetzt im August beim Aufbau-Verlag erschien. Nur so gelingt es Guez, der sich als Co-Autor des Drehbuches zum Spielfilm „Der Staat gegen Fritz Bauer“ (2015) schon Jahre zuvor intensiv mit der strafrechtlichen Verfolgung der nach dem Krieg außer Landes geflohenen Nazi-Kriegsverbrecher und Auschwitz-Mörder beschäftigt hatte, in diesem Buch nicht nur die abstrakte Figur deutscher Geschichte und den „Todesengel von Auschwitz“ zu beschreiben, sondern Josef Mengele (1911-1979) auch als Menschen zwischen Todesangst und Arroganz während seines 35 Jahre dauernden erbärmlichen Lebens in lateinamerikanischen Verstecken zu zeigen. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 12.08.2018 | ||

|
Nach Erscheinen des ersten Bandes („Der Hirte“, Verlag Blanvalet, 2017) seiner Thriller-Trilogie um den Osloer Hauptkommissar Fredrik Beier und dessen Kollegin Kafa Iqbal wurde der norwegische Autor Ingar Johnsrud (44) in Deutschland von Kritikern prompt als neuer Stern am skandinavischen Thriller-Himmel und sogar als Nachfolger von Stieg Larsson oder Henning Mankell gerühmt. Ich mochte damals diesem Urteil nicht folgen, zu verwirrend war mir die Handlung, zu klischeehaft die Charaktere. Im Mai erschien nun „Der Bote“ als zweiter Band, der eineinhalb Jahre nach dem „Hirten“ in Oslo spielt, sich aber trotz vereinzelter Rückblicke durchaus ohne Vorkenntnisse als in sich abgeschlossener Thriller lesen lässt. Diesen „Boten“ fand ich etwas besser, zumal er gleich zwei Genres in einem Band vereint – das des Psychothrillers und des Politthrillers. |
|
| Bewertung vom 05.08.2018 | ||
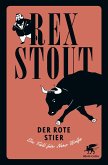
|
Der rote Stier / Nero Wolfe Bd.7 Vielleicht nicht unbedingt auf gleichem Niveau wie „Es klingelte an der Tür“ (März 2017) oder „Zu viele Köche“ (November 2017), aber voller Geist und Witz immer noch um Längen besser als die bluttriefenden Psychothriller heutiger Zeit ist der schon vor 80 Jahren erstmals erschienene, im April bei Klett-Cotta nun als dritter Band der Neuausgabe veröffentlichte Krimi „Der rote Stier“ des amerikanischen Bestseller-Autors Rex Stout (1886-1975). Obwohl Stout eher als politischer Schriftsteller bekannt ist, der seine vielschichtige Kritik an Staat und Gesellschaft in spannende Kriminalfälle um den Orchideen züchtenden Meisterdetektiv Nero Wolfe verpackte, geht es diesmal eher um gutes, vielleicht auch nicht so gutes Essen. Aber auch darin ist übergewichtige Nero Wolfe, der üblicherweise sein Haus nicht verlässt, dafür seinen „Laufburschen“ Archie Goodwin hat, ein Meister auch dieses Faches. |
|
| Bewertung vom 30.07.2018 | ||

|
Commissaire Le Floch und der Brunnen der Toten / Commissaire Le Floch Bd.2 Die französische, 13-bändige Krimireihe um den jungen Commissaire Nicolas Le Floch, der im Paris des Jahres 1761 zur Zeit Ludwigs XV. und der beginnenden Aufklärung geheimnisvolle Morde aufzudecken hat, sei „ein literarischer Genuss“, schrieb ich im Herbst 2017 über den mit 20-jähriger Verzögerung erstmals auf Deutsch veröffentlichten Band „Commissaire Le Floch & und das Geheimnis der Weißmäntel“ des im Mai verstorbenen französischen Schriftstellers Jean-François Parot (1946–2018). Mein Fazit damals: „Le Floch macht süchtig!“ Nach Lektüre dieses zweiten Bandes „Commissaire Le Floch & der Brunnen der Toten“, im März wieder im Blessing-Verlag erschienen, kann ich mein damaliges Urteil mit bestem Gewissen bestätigen. |
|
| Bewertung vom 26.07.2018 | ||

|
Wer von Bestseller-Autor Henning Mankell (1948-2015) nur die Wallander-Krimis kennt, durch die der schwedische Schriftsteller in den Neunziger Jahren international bekannt wurde, wird bei Lektüre seines 1973 veröffentlichten Debütromans „Der Sprengmeister“, der vor wenigen Tagen im Paul Zsolnay Verlag erstmals auf Deutsch erschienen ist, sicherlich seine Probleme haben. Sogar erfahrene Mankell-Leser, die noch andere Romane von ihm kennen, dürften staunen: „Der Sprengmeister“ ist ganz anders! |
|
| Bewertung vom 25.07.2018 | ||

|
„Historisch interessant, packend und berührend, zugleich trotz der Dramatik der beschriebenen Jahre immer wieder erfrischend und hoffnungsfroh stimmend“, schrieb ich über das mit über 40.000 verkauften Exemplaren erfolgreiche Buch „Im Lautlosen“ (2017) von Melanie Metzenthin (49), bekannt als Autorin einiger im Mittelalter spielender Romane und Ärztin in Hamburg. Diesen Satz wiederhole ich auch gern für den jetzt im Juli ebenfalls im Amazon-Verlag Tinte & Feder erschienenen zweiten Band „Die Stimmlosen“. |
|