BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 501 Bewertungen| Bewertung vom 23.02.2021 | ||

|
Peter Stamm war mir vor der Lektüre seiner Anthologie „Wenn es dunkel wird“ kein Begriff. Und da mich die 11 Kurzgeschichten der Sammlung sehr zwiegespalten zurücklassen, wird er mir wohl auch nicht wirklich im Gedächtnis bleiben. Schlecht ist das Buch nicht, aber von den Geschichten treffen nur sehr wenige meinen Geschmack. |
|
| Bewertung vom 19.02.2021 | ||
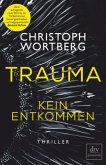
|
Kein Entkommen / Katja Sand Trilogie Bd.1 Ich gebe es zu: ich kannte Christoph Wortberg vorher nur aus der Lindenstraße. Deshalb habe ich mich auf sein Buch „Trauma – Kein Entkommen“ sehr gefreut und meine Erwartungen wurden auch vollständig erfüllt. Zwar war es für mich nicht wie angekündigt ein Thriller, aber ein solider, spannender und gut ausgearbeiteter Krimi, in dem auch die psychologische Komponente gut recherchiert und gekonnt aufgearbeitet ist, denn der Autor nimmt die Leserschaft mit auf eine Reise in die tiefen Abgründe der menschlichen Psyche. |
|
| Bewertung vom 19.02.2021 | ||
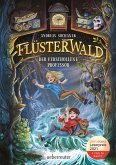
|
Flüsterwald - Der verschollene Professor (Flüsterwald, Staffel I, Bd. 2) Neues aus dem Flüsterwald. Die Abenteuer von Lukas und seinen Freunden gehen weiter. |
|
| Bewertung vom 18.02.2021 | ||
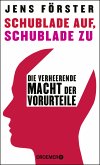
|
„Wie gelingt der Blick hinter unsere Vorurteile?“, was sind Vorurteile überhaupt und wie entstehen sie? – das sind nur ein paar der Themen, die Dr. Jens Förster in seinem Buch „Schublade auf, Schublade zu. Die verheerende Macht der Vorurteile“, erörtert. Herausgekommen ist bei dieser Mammut-Aufgabe ein Buch, das den Spagat zwischen Unterhaltung und Sachbuch hervorragend meistert. |
|
| Bewertung vom 18.02.2021 | ||
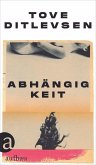
|
Abhängigkeit / Die Kopenhagen-Trilogie Bd.3 „Abhängigkeit” ist der deutsche Titel des dritten und letzten Teils von Tove Ditlevsens autobiografischer „Kopenhagen-Trilogie“. Im Original hieß das Buch „Gift“, also „verheiratet“ – beide Titel passen exakt zum Inhalt des Buchs. Denn es dreht sich um Toves Ehen und ihre Abhängigkeit, sowohl die Abhängigkeit von Männern, als auch von Drogen. Insgesamt war sie viermal verheiratet. Dieses Buch ist in zwei Teile gegliedert, der erste umfasst ihre ersten beiden Ehen, der zweite ihre Sucht und ihr Verhältnis mit und zu ihrem dritten Mann. |
|
| Bewertung vom 15.02.2021 | ||
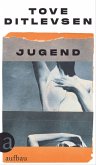
|
Jugend / Die Kopenhagen-Trilogie Bd.2 „Jugend” ist der zweite Teil der „Kopenhagen Trilogie“ von Tove Ditlevsen. Ursprünglich waren die ersten beiden Teile „Kindheit“ und „Jugend“ 1969 in dem Band „Den tidlig forår“ veröffentlich worden, auf Deutsch erscheint die Trilogie über 40 Jahre nach Tove Ditlevsens Tod zum ersten Mal. Das Buch schließt nahtlos an den ersten Band an, die Autorin beschreibt die Zeit nach ihrer Konfirmation, also ab dem Alter von etwa 14 Jahren. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 10.02.2021 | ||
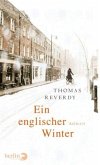
|
Anfangs tat ich mich zugegebenermaßen mit Thomas Reverdys „Ein englischer Winter“ etwas schwer. Die fragmentierte Schreibweise und die verschiedenen Handlungsstränge bildeten für mich auf den ersten Seiten einfach keine Einheit. Aber als ich mich an den Stil des Autors gewöhnt hatte, habe ich das Buch in einer Tour durchgelesen. Stilistisch ähnelt das Buch für mich mehr einer Novelle als einem Roman, denn es hat weder einen wirklichen Anfang, noch einen richtigen Schluss. Das tat der der Lesefreude aber keinen Abbruch. |
|
| Bewertung vom 10.02.2021 | ||
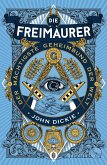
|
Die Freimaurer - Der mächtigste Geheimbund der Welt Umfangreicher Einblick in die Freimaurerei, von der Entstehung bis heute |
|
| Bewertung vom 04.02.2021 | ||

|
Seit ich einen Vortrag von Niels Krøjgaard, einem dänischen „psychologischen Entertainer“ und Fachmann für nonverbale Kommunikation, gehört habe, ist Gesichtslesen für mich ein interessantes Thema. Deshalb habe ich mich über das Buch „Ich lese dich: Geheimnisse eines Facereaders“ von Eric Standop sehr gefreut. Und völlig enttäuscht hat das Buch mich nicht, aber fast. Denn es bleibt weit hinter den Werken von Paul Ekman oder von Joe Navarro über Mikroexpressionen und deren Deutung zurück. |
|
| Bewertung vom 26.01.2021 | ||

|
Hätten Bücher eine farbige Aura, dann wäre „Der Mann im Strom“ von Siegfried Lenz für mich grau in grau. Das 1957 erstmals erschienene Buch über den Berufstaucher Hinrichs, der außerdem alleinerziehender Vater von Timm und Lena ist, hat für mich eine durchweg bedrückende Stimmung, was es natürlich nicht zu einem schlechten Buch macht. Gegen Ende wird es unterschwellig spannend und alles in allem fand ich es unglaublich intensiv erzählt. |
|
