BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 501 Bewertungen| Bewertung vom 21.01.2021 | ||
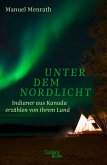
|
Kanada ist für viele ein Wohlfühl- oder Sehnsuchtsort, bei dem man an eine offene und liberale Gesellschaft, das „bessere Amerika“, denkt. Zumindest hört und liest man das immer wieder. Aber ganz so ist es nicht. Manuel Menrath beleuchtet in seinem Buch „Unter dem Nordlicht- Indianer aus Kanada erzählen von ihrem Land“ die eher unrühmlichen Aspekte der Geschichte des Landes. Heute leben „auf dem kanadischen Territorium 634 vom Staat anerkannte indianische „Stammesgemeinschaften“, die offiziell als First Nations bezeichnet werden und die etwa 3000 Reservate besitzen.“ Dennoch treten die Angehörigen indigene Völker heute in Kanada kaum in Erscheinung, ihr Beitrag zur Geschichte des Landes wird meist schlicht ignoriert oder „vergessen“. „So entsteht der Eindruck, alles, was vorher (also vor der Besiedelung durch die Europäer) gewesen war, sei bedeutungslos.“ |
|
| Bewertung vom 18.01.2021 | ||
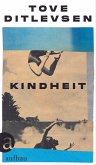
|
Kindheit / Die Kopenhagen-Trilogie Bd.1 „Kindheit” ist der erste Teil der „Kopenhagen-Trilogie” von Tove Ditlevsen, posthum rund 44 Jahre nach ihrem Selbstmord veröffentlicht. Es war mein erstes Buch der Autorin, aber sicher nicht mein letztes. Die Dichte, mit der sie schreibt, die Wortgewalt in ihren eigentlich schlichten Sätzen und natürlich die Geschichte an sich, hatten mich von der ersten Seite an gepackt. |
|
| Bewertung vom 07.01.2021 | ||
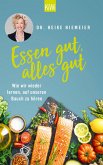
|
„Essen gut, alles gut. Wie wir wieder lernen, auf unseren Bauch zu hören“ von Dr. Heike Niemeier ist schlicht und einfach eines der besten Bücher über Ernährung, das ich bislang gelesen habe. Die promovierte Ökotrophologin bringt das schwierige und äußerst komplexe Thema fachlich fundiert, umfassend und anschaulich auf den Punkt. Gewürzt mit teils launigen, immer aber lehrreichen Geschichten über ihre Erfahrungen mit Klient*innen aus ihrem Alltag als Ernährungsberaterin, Rezepten und Anleitungen zu Selbstversuchen, hat sie einen umfangreichen Ernährungsratgeber geschaffen. Aber das Buch ist noch mehr als das ist: es ist ein lesenswerter, informativer und umsetzbarer Ernährungs-Leitfaden. Denn schlussendlich müssen wir alle irgendwie essen, Lebensmittel sind nämlich schlicht Mittel zum Leben. |
|
| Bewertung vom 06.01.2021 | ||

|
Zugegeben, „Ihr Königreich“ war mein erstes Buch von Jo Nesbø, vermutlich aber auch mein letztes, denn so wirklich warm konnte ich damit nicht werden. Dabei ist es an sich gar kein schlechtes Buch. Ich musste aber immer mal wieder aufs Titelblatt schauen, ob es sich tatsächlich um einen Krimi handeln soll, denn über weite Strecken ist das Buch ein (gut geschriebener und nett zu lesender) Familienroman, bestenfalls ein Drama in sieben Akten. Zwar ist latent beim Lesen ein stetig ungutes Gefühl spürbar, wie eine omnipräsente dunkle Wolke, die über dem Berghof der Brüder (ihrem Königreich) und dem nahen Abgrund zu schweben scheint, aber wirklich Spannung konnte ich wenig feststellen. Abgebrochen habe ich das Buch allerdings auch nicht, für mich war es wie ein Verkehrsunfall – eigentlich wollte ich es weglegen, aber so wirklich losreißen konnte ich mich dann doch nicht davon, zu groß war meine Neugier, ob der Autor die Kurve zu einem spannenden Buch doch noch bekommt.. |
|
| Bewertung vom 05.01.2021 | ||
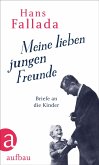
|
„Meine lieben jungen Freunde: Briefe an die Kinder“ von Hans Fallada, herausgegeben von Nele Holdack, ist ein schmaler Band (das Buch hat nur 144 Seiten), in dessen erstem Teil augenscheinlich nicht mal wirklich viel steht. Kennt man aber die Biografie des Schriftstellers, dann steht zwischen den Zeilen sehr viel und im zweiten Teil noch viel mehr. Außerdem besteht nur der erste Teil des Buchs aus Briefen, aber nicht an DIE Kinder, sondern fast ausschließlich an seine Tochter Lore, genannt Mücke, die als Neunjährige ein Internat in Hermannswerder bei Potsdam besuchte, da es in der ländlichen Heimat nur eine Dorfschule gab. Die Briefe an seinen Sohn Uli, der im Internat in Templin (Uckermark) war, sind übrigens in „Mein Vater und sein Sohn“ erschienen. Den zweiten Teil macht ein Vortrag aus, den Fallada für den literarischen Verein seines Sohnes Ulrich schrieb (und auch hielt). Von diesem stammt auch der Titel des Buchs. |
|
| Bewertung vom 04.01.2021 | ||
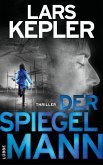
|
Der Spiegelmann / Kommissar Linna Bd.8 Endlich ein neuer Joona-Linna-Thriller! Mit „Der Spiegelmann“ haben Lars Kepler (dahinter verbirgt sich ja bekanntlich ein Autoren-Duo) den achten Teil der Serie veröffentlicht und reißen ihre Leser mit in einen Strudel aus Gewalt, Brutalität und Mord. |
|
| Bewertung vom 21.12.2020 | ||
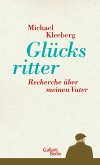
|
„Glücksritter. Recherche über meinen Vater“ ist der Titel von Thomas Kleebergers Roman und gleichzeitig ist dieser Titel Programm. Denn sein Vater, dem er sich nach dessen Tod anzunähern versucht, scheint sein Leben lang auf der Suche nach dem Glück zu sein („Glück ist etwas gewesen, dem mein Vater sein Leben lang hinterher gejagt hat“). Aber er war zwar ein Glücksritter, aber weniger ein Ritter ohne Furcht und Tadel, sondern eher einer von der traurigen Gestalt. |
|
| Bewertung vom 15.12.2020 | ||

|
Die schönsten bretonischen Sagen In meiner Kindheit waren es „Grimms Märchen“ oder der „Große Märchenschatz“, die mir meine Oma abends vorgelesen hat. Die Faszination hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, daher habe ich mich auf und über „Die schönsten bretonischen Sagen“ ganz besonders gefreut. Herausgegeben wird das Buch von Jean- Luc Bannalec, dem Schöpfer des Buch- und Fernsehkommissars Dupin, und Tilmann Spreckelsen, der dem einen oder anderen Krimi-Fan durch sein Buch „Nordseegrab“ ein Begriff sein dürfte. Diese Sagen-Sammlung ist ganz sicher nichts für Kinder, sondern ein wahres Füllhorn an Geschichten für Erwachsene. |
|
| Bewertung vom 11.12.2020 | ||
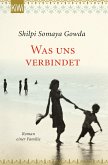
|
Karina und Prem, die beiden Kinder der Familie Olander sind ein Herz und eine Seele. Die indisch-amerikanische Familie, die im Mittelpunkt von Shilpi Somaya Gowdas Roman „Was uns verbindet“ steht, ist von England in die USA ausgewandert. Die Eltern Yaya und Keith haben es zu etwas Wohlstand gebracht, Haus mit Pool, gute Schule für die Kinder und ein weitgehend sorgenfreies Leben. Karina hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren jüngeren Bruder zu beschützen. Und ausgerechnet sie ist alleine mit ihm zu Hause, als der Achtjährige im Pool ertrinkt. |
|
| Bewertung vom 11.12.2020 | ||
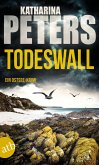
|
Da ich die Autorin schon von „Fischermord“ und „Bornholmer Schatten“ kannte, habe ich mich auf den neuen Krimi von Katharina Peters sehr gefreut. Zwar ist „Todeswall“ schon der fünfte Teil der Emma-Klar-Serie, die ich bislang noch nicht kannte, aber auch diese Ermittlerin konnte bei mir von Anfang an punkten. Sie war mir sofort ebenso sympathisch wie Romy Beccare und Sara Pirohl. |
|
