BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 501 Bewertungen| Bewertung vom 08.12.2020 | ||
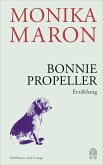
|
„Bonnie Propeller“ ist, anders, als der Name eventuell vermuten lassen könnte, kein Flugzeug, sondern ein Hund und der Name einer Erzählung. Bonnie ist ein ungarischer Adoptivhund, der den verstorbenen Rüden der Autorin Monika Maron ersetzen soll. Und da liegt auch schon der Hund begraben und des Pudels Kern, jetzt aber genug mit schlechten Wortspielen. Die Autorin möchte mit einem neuen Hund den verstorbenen Gefährten ersetzen, wie sie es vorher schon einmal gemacht hat. Auf Bruno folgte Momo und auf Momo nun Propeller. Der Name missfiel ihr von Anfang an und mit Bonnie war schnell ein neuer gefunden. 3 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 08.12.2020 | ||
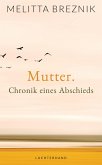
|
Chronik des Sterbens. Melitta Breznik hat als Ärztin eine eher professionelle Einstellung zum Tod. Aber als es um das Sterben ihrer eigenen Mutter geht, kommt sie psychisch und physisch an ihre Grenzen. Ihre Erfahrungen mit dem Leiden und Sterben hat sie in ihrem Buch „Mutter. Chronik eines Abschieds“ aufgeschrieben und damit ein unglaublich emotionales und zutiefst berührendes Werk geschaffen. |
|
| Bewertung vom 04.12.2020 | ||
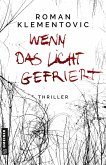
|
Im September 1997 verschwindet die 17 jährige Anna Venz am Tag vor ihrem 18. Geburtstag. Zwei Tage später wird ihre Leiche nackt im Moor gefunden. 22 Jahre später greift eine Fernsehsendung diesen Cold Case auf und reißt alte, bei weitem nicht verheilte Wunden wieder auf. Mittendrin ist Elisabeth, die Mutter von Valerie, die vor 22 Jahren die beste Freundin des Opfers war. Sie beschleicht ein schrecklicher Verdacht: könnte ihr an Alzheimer erkrankter Ehemann Friedrich der „Moormörder“ sein? Aus ihrer Sicht wird die Geschichte erzählt, sie versucht selbst, den Mörder zu finden, um für sich selbst die Gewissheit zu haben. Mehr möchte ich zum Inhalt von Roman Klementovics Krimi „Wenn das Licht gefriert“ gar nicht sagen. Denn die Geschichte ist so voller Misstrauen, (falschem) Verdacht, Angst, Trauer und Wut, dass man nicht viel mehr darüber sagen kann, ohne zu spoilern. |
|
| Bewertung vom 04.12.2020 | ||

|
»Nichtalltägliches aus dem Leben eines Beamten« und »Einladung zum Klassentreffen« (eBook, ePUB) „Nichtalltägliches aus dem Leben eines Beamten“ ist der Titel des ersten Theaterstücks von Martin Schörle aus dem gleichnamigen Buch |
|
| Bewertung vom 30.11.2020 | ||
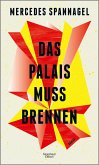
|
„Ich hatte früh eine Abscheu in mir. Ich hatte früh Revolution in mir. Ich war antiautoritär verwahrlost. Ich war verwöhnt. Ich war schwierig, von Anfang an.“ – diese Sätze sind für mich die Quintessenz aus Mercedes Spannagels Erstlingswerk „Das Palais muss brennen“. Ihre Protagonistin Luise, Tochter der österreichischen Bundespräsidentin, kann man nämlich meiner Meinung nach mit Fug und Recht als „wohlstandsverwahrlost“ bezeichnen. Aus dem Plattenbau ins „Palais“ gezogen, sucht Lu ihren Weg und sich selbst und vor allem eine Möglichkeit, sich von ihrer Mutter und ihrer politischen Ausrichtung (sie ist Spitzenpolitikerin „einer superrechten Partei“) zu emanzipieren. |
|
| Bewertung vom 24.11.2020 | ||
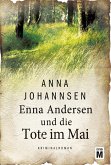
|
Enna Andersen und die Tote im Mai „Enna Andersen und die Tote im Mai“ ist Anna Johannsens neuer Krimi aus der „Enna-Andersen-Reihe“. Es ist zwar schon der zweite Teil der Serie, aber man kann ihn problemlos auch ohne Vorkenntnisse lesen. |
|
| Bewertung vom 23.11.2020 | ||
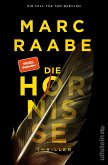
|
Die Hornisse / Tom Babylon Bd.3 Nach „Schlüssel 17“ und „Zimmer 19“ hat Marc Raabe mit „Die Hornisse“ den dritten Teil seiner Serie um Kommissar Tom Babylon nachgelegt. Leider finde ich den Titel ungünstig gewählt, da Patricia Cornwells Thriller „A hornet’s nest“ ebenfalls mit „Die Hornisse“ übersetzt wurde. Aber das nur am Rande, denn für mich stand Marc Raabes neues Werk in puncto Spannung dem von Patricia Cornwell in nichts nach. |
|
| Bewertung vom 23.11.2020 | ||

|
Für mich war das Buch leider eher eine Nullnummer. |
|
| Bewertung vom 23.11.2020 | ||
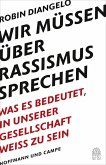
|
Wir müssen über Rassismus sprechen „Wir müssen über Rassismus sprechen“ von Robin J. DiAngelo ist ein Buch zu einem unfassbar wichtigen und aktuellen Thema, das den Leser mehr oder weniger direkt angreift und aufrütteln möchte. Die Autorin ist Soziologin und hat sich daher wissenschaftlich mit Rassismus beschäftigt und daraus ein Sachbuch gemacht, das sich auch aufgrund der vielen Fußnoten, nicht unbedingt flüssig lesen lässt. |
|
| Bewertung vom 18.11.2020 | ||
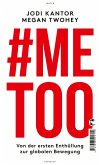
|
Inzwischen ist es etwas ruhiger um die #Me too-Bewegung geworden, dennoch hat sich dieser Hashtag sicher vielen Menschen unauslöschlich ins Gedächtnis gegraben und für viele hat er nichts an Aktualität verloren. Mit ihrem Buch „#Me too“ haben Megan Twohey und Jodi Kantor einen umfassenden Überblick über die Recherchen zum Thema veröffentlicht. Die beiden Journalistinnen hatten mit ihren Recherchen speziell zum amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein und seinem zweifelhaften Umgang mit Frauen recherchiert. Das Buch ist überaus schockierend und (trotz der sachlichen und journalistischen Form) flüssig zu lesen, teils sogar Krimi-artig spannend. |
|
