BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 330 Bewertungen| Bewertung vom 28.09.2019 | ||
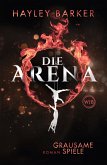
|
Grausame Spiele / Die Arena Bd.1 „Die Arena – Grausame Spiele“ ist der erste Teil einer Dilogie der Engländerin Hayley Barker. Die Geschichte spielt im London der Zukunft, in etwa hundert Jahren. Zu dieser Zeit zieht ein Zirkus über die britische Insel, der vor bereits rund 40 Jahren gegründet wurde. In ihrer Arena finden jedoch keine Vorführungen wie wir sie heute kennen statt, sondern es wird den Zuschauern ein besonderer Nervenkitzel dadurch geboten, dass die Künstler ohne eine Absicherung auftreten oder per Losverfahren über den Ausgang einer Zirkusdarbietung bestimmt wird. |
|
| Bewertung vom 09.09.2019 | ||

|
In ihrem Roman „Der Sprung“ beschreibt Simone Lappert zu Beginn eine prekäre Situation, denn eine junge Frau steht auf dem Dach eines Hauses in Thalbach in der Nähe von Freiburg. Sie bleibt nicht ungesehen und Polizei und Feuerwehr sichern schon bald die Umgebung ab. Der polizeilichen Aufforderung, vom Dach zu steigen, kommt sie nicht nach. Immer mehr Menschen werden auf die junge Frau namens Manuela aufmerksam, denn nicht nur sie, sondern auch ich als Leser erwarteten ihren Sprung, der auch eintreten wird, wie der Prolog mich wissen ließ. |
|
| Bewertung vom 05.09.2019 | ||
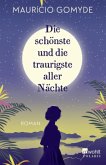
|
Die schönste und die traurigste aller Nächte Die schönste und die traurigste aller Nächte war für Victor und Amanda, den beiden Protagonisten im gleichnamigen Buch von Mauricio Gomyde, die Nacht des Abschlussballs ihrer Schule in Brasilia/Brasilien im Jahr 1997. Beide sind 17 Jahre alt und in dieser Nacht küssen sie sich zum ersten Mal. Doch Victor weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass der Beginn ihrer Liebe gleichzeitig verbunden ist mit dem bevorstehenden Umzug von Amanda und ihrer Familie nach Kenia und zwar schon am nächsten Tag. Der Kontakt zueinander bricht ab. Zwanzig Jahre später erhalten beide eine Einladung zum Jahrgangstreffen. Obwohl beide Gründe haben, daran nicht teilzunehmen, entscheiden sie sich für eine Zusage, die ihr Leben komplett verändern wird. |
|
| Bewertung vom 04.09.2019 | ||

|
„Levi“ ist der Debütroman von Carmen Buttjer. Die Handlung spielt in Berlin in der Gegenwart. Im Mittelpunkt steht der 11-jährige Levi Naquin, der erst vor etwa einem halben Jahr mit seinen Eltern in die Bundeshauptstadt gezogen ist. Es sind Sommerferien, doch statt Levis Familie bei Ferienaktivitäten zu erleben, traf ich den Jungen und seinen Vater auf den ersten Seiten des Buchs bei der Beerdigung von Levis Mutter. Levi schafft es kaum, ruhig sitzen zu bleiben. In einer spontanen Aktion greift er die Urne, läuft damit nach Hause und richtet sich in einem Versteck auf dem Dach des Mehrfamilienhauses ein. |
|
| Bewertung vom 28.08.2019 | ||
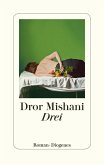
|
Der israelische Autor Dror Mishani bezeichnet seine Geschichte „Drei“ als „Detektivroman“, darüber wunderte ich mich zunächst. Warum die Bezeichnung dennoch treffend ist, lässt sich erst nach dem Lesen abschließend beurteilen. Entsprechend seines Titels ist die Erzählung in drei Teile gegliedert, in denen jeweils eine Frau die Protagonistin ist. Die drei Frauen haben eine Gemeinsamkeit: sie sind auf der Suche, jede auf ihre Art. Außerdem spielt ein Rechtsanwalt in jedem der Abschnitte eine Rolle. Der Haupthandlungsort ist Tel Aviv. |
|
| Bewertung vom 22.08.2019 | ||
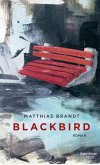
|
In seinem Roman „Blackbird“ erzählt Matthias Brandt von einer Jugend am Ende der 1970er. Den Titel hat er einem Song der Beatles entlehnt, der ursprünglich auf Diskriminierung bezogen ist, hier aber auf die Krankheit des besten Freunds des Protagonisten abzielt. Auf einer Bank abhängen, bisschen Alkohol trinken und rauchen, was auch immer, so stellt es sich der 15-jährige Morten Schumacher, kurz Motte gerufen, vor, wenn er mit seinem Klassenkameraden Bogi nach der Schule zusammen ist. Noch während er zu Hause mit der Scheidung seiner Eltern konfrontiert wird, erkrankt sein Freund so schwer, dass erstmal nicht an gemeinsame Freizeitgestaltung zu denken ist. Im Lied der Beatles heißt es „Take these broken wings and fly“, diese Liedzeile wird sich auf andere Weise verwirklichen als Motte und seine Freunde es sich für Bogi gewünscht hätten. 1 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 18.08.2019 | ||

|
In ihrem Roman „Es wird Zeit“ schreibt Ildikó von Kürthy darüber, dass es immer wieder Herausforderungen gibt, die das Leben mit sich bringt. Das bedeutet oft, dass man Bekanntes, vielleicht sogar Gewünschtes oder aber bequem Eingespieltes hinter sich gelassen werden will und die Entscheidung für einen Neuanfänge zu treffen ist. Die Rosen auf dem Buchumschlag stehen mit ihrer stolzen Pracht für glückliche Zeiten, zeigen aber auch durch ihre Dornen die Schattenseiten und Gefahren. |
|
| Bewertung vom 14.08.2019 | ||
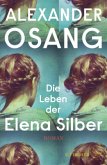
|
Mit dem Roman „Die Leben der Elena Silber“ von Alexander Osang näherte ich mich beim Lesen der möglichen Wahrheit über den Lebensweg der im russischen Gorbatow geborenen Jelena Viktorowna Krasnowa. Bereits der Umschlag deutet an, dass so ein erzähltes Leben sich aus vielen Bildern, die da im Kopf hängen bleiben, zusammensetzt. Jelena, Elena, Lena, je mehr Buchstaben ihr Vornamen verliert, desto mehr Menschen verliert sie, die ihr bisher Halt gegeben haben, denen sie vertraut hat und von denen sie hilfreich unterstützt wurde. Den Blick immer auf die Zukunft gerichtet, umschifft sie viele Hindernisse. Die Sorge um ihre Familie begleitet sie ständig, durch die politischen Wirrungen des letzten Jahrhunderts muss sie sich immer wieder anpassen. Dennoch ist sie nicht die einzige Protagonistin des Romans, ihr Enkel Konstantin ist eine weitere Hauptfigur. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 10.08.2019 | ||
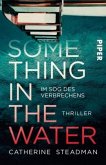
|
Something in the Water - Im Sog des Verbrechens Something in the water“ ist ein Thriller der Engländerin Catherine Steadman, der eine subtile Spannung aufbaut, die sich vor allem aus dem Umstand ergibt, dass die Protagonisten Erin und Mark in ihren Flitterwochen bei einem Ausflug eine Tasche aus dem Wasser fischen mit einem brisanten Inhalt. Schon der Untertitel des Buchs „Im Sog des Verbrechens“ deutet an, dass eine verwerfliche Tat weitreichende Konsequenzen haben wird. |
|
| Bewertung vom 14.09.2018 | ||

|
Der Engländer Christopher Wilson nimmt den Leser in seinem Roman „Guten Morgen, Genosse Elefant“ mit in die Sowjetunion ins Jahr 1953. Es ist das Ende der Stalinzeit und der Protagonist Juri erlebt diesen Zeitraum aus einer ganz besonderen persönlichen Sicht. So schmückt denn auch ein fünfzackiger roter Stern das Cover des Buchs, hier als Symbol für eine kommunistische beziehungsweise sozialistische Weltanschauung. Unterbrochen wird der Stern durch einen Löffel. Er steht für den Job des Vorkosters, den Juri einnehmen wird. Die Elefanten im oberen Bereich sowie der Titel beziehen sich auf den Tarnnamen, den der damalige Diktator der Sowjetunion von einem Mitarbeiter erhält und damit dessen Gewichtigkeit betont. |
|
