BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 874 Bewertungen| Bewertung vom 21.02.2020 | ||
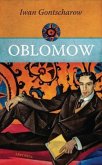
|
Schlafrock-Existenz als Allegorie |
|
| Bewertung vom 14.02.2020 | ||

|
Unselige Allianz von Schicksal und Zufall |
|
| Bewertung vom 10.02.2020 | ||

|
Grieche trifft Schwedin |
|
| Bewertung vom 07.02.2020 | ||

|
Wir sehen uns dort oben / Die Kinder der Katastrophe Bd.1 Makabre Schwejkiade |
|
| Bewertung vom 31.01.2020 | ||

|
Eine multiple Persönlichkeit 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 29.01.2020 | ||

|
Ein narratives Verwirrspiel |
|
| Bewertung vom 26.01.2020 | ||

|
Das Schöne, Schäbige, Schwankende Konglomerat literarischer Vignetten |
|
| Bewertung vom 21.01.2020 | ||

|
Phantasiekompetenz gefragt |
|
| Bewertung vom 21.01.2020 | ||

|
Geistige Wegbereiter der DDR 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
