BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 874 Bewertungen| Bewertung vom 09.11.2019 | ||

|
Nicht bewältigtes, narratives Chaos 1 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 06.11.2019 | ||

|
Mein Jahr in der Niemandsbucht Nichts für «Lesefutterknechte» |
|
| Bewertung vom 29.10.2019 | ||

|
Überstrapazierte Emotionslosigkeit |
|
| Bewertung vom 27.10.2019 | ||

|
Geschichte ohne Fazit |
|
| Bewertung vom 25.10.2019 | ||
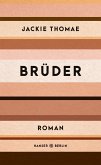
|
Ein Symptom der Zeit |
|
| Bewertung vom 21.10.2019 | ||

|
Debüt eines literarischen Olympiers |
|
| Bewertung vom 18.10.2019 | ||

|
Schwarze Löcher als Metapher |
|
| Bewertung vom 15.10.2019 | ||
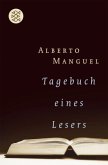
|
Geschmälerte Lesefrüchte |
|
| Bewertung vom 12.10.2019 | ||

|
Der Proll als Millionär |
|
