BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 874 Bewertungen| Bewertung vom 06.10.2019 | ||
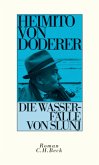
|
Der Poet als gottgleicher Schöpfer 3 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 01.10.2019 | ||

|
Danksagung als raffinierte Ergänzung 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 26.09.2019 | ||

|
Satirische Dystopie |
|
| Bewertung vom 24.09.2019 | ||

|
Vom Dilemma femininer Selbstverwirklichung |
|
| Bewertung vom 21.09.2019 | ||

|
Tragischer Pantoffelheld 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 19.09.2019 | ||

|
Lebt wohl, Ihr Genossen und Geliebten! Ein literarisches Requiem 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 18.09.2019 | ||

|
Der Club der toten Dichter |
|
| Bewertung vom 14.09.2019 | ||

|
Die allertraurigste Geschichte Subversive Erzählweise |
|
| Bewertung vom 11.09.2019 | ||

|
Expertise eines Insiders |
|
