Insgesamt 85 Bewertungen
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 2 Zur Seite 2 3 Zur Seite 3 4 Aktuelle Seite 5 Zur Seite 5...Weitere Seiten9Zur letzten Seite, Seite 9Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 2 Zur Seite 2 3 Zur Seite 3 4 Aktuelle Seite 5 Zur Seite 5...Weitere Seiten9Zur letzten Seite, Seite 9Zur nächsten SeiteZur letzten Seite




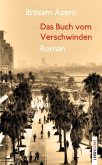

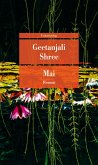



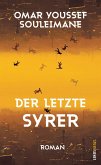


Benutzer