BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 50 Bewertungen| Bewertung vom 16.01.2023 | ||

|
Frank ist vierzehn – das heißt, „noch nicht ganz. Wegen dem knappen Monat, der fehlt, glaube ich, kann ich doch sagen, ich bin vierzehn“ (S. 9) – und wohnt mit seiner Mutter in Wien. Das Leben hat sie zusammengeschweißt, sie sind ein eingespieltes Team. |
|
| Bewertung vom 17.12.2022 | ||
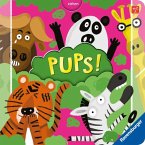
|
Das Buch mit dem Titel „Pups – Wer war’s?“ hat hier sowohl bei Tochter als auch bei Mutter für große Vorfreude gesorgt. |
|
| Bewertung vom 24.08.2022 | ||

|
Stefanie vor Schulte hat sich in ihrem zweiten Werk eines schwierigen und unliebsamen Themas angenommen: Trauerarbeit. Sie erschafft ungewöhnliche, wirkungsvolle, teilweise verstörende, irrwitzige Bilder, die aufzeigen, wie unterschiedlich die einzelnen Menschen trauern. |
|
| Bewertung vom 22.07.2022 | ||

|
Das bunte Cover hat auf mich eine geradezu magische Wirkung ausgeübt und nach der Leseprobe wusste ich, dass ich dieses Buch unbedingt lesen muss! |
|
| Bewertung vom 22.07.2022 | ||

|
Die Ewigkeit ist ein guter Ort "Mein Vater war Pastor einer evangelischen Kirchengemeinde. Ich hatte schon als Kind auf der Kanzel gespielt, von der er eines Tages verkünden würde, wer ihm nachfolgen sollte. Dass ich das sein könnte, wünschten meine Eltern sich schon lange. (…) „Ich muss erst den Kopf frei kriegen“, sagte ich, „bevor ich gleich eine ganze Gemeinde übernehme.“ Mein Vater nickte etwas heftiger als nötig, dem Sekt geschuldet oder der Erleichterung, dass er nicht sofort in Rente gehen musste. „Du sagst Bescheid, wenn du so weit bist.“ Ich nickte, aber das war jetzt ein Jahr her, und mein Kopf war immer noch nicht frei. Und jetzt war der Schöpfer des Himmels und der Erden mir zuvorgekommen und hatte die Arbeit für mich erledigt. Gott hatte den Platz geräumt…" (S. 10) 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 27.06.2022 | ||

|
Sonne, Mond und Sterne / Wieso? Weshalb? Warum? Junior Bd.72 „Sonne, Mond und Sterne“ ist ein Sachbuch, das speziell für die Kleinsten (Altersangabe des Verlags: 2 bis 4 Jahre) konzipiert wurde. Dies merkt man schon ab der ersten Seite. Denn wo sich andere Kinderbücher zu diesem Thema mit Umlaufbahnen, Raketentechnik und Weltraumnahrung beschäftigen, liegt der Schwerpunkt hier auf dem alltäglichen Erleben: am Abend wird es dunkel – aber warum? Wieso brauchen wir die Sonne? Erst nach dieser sehr praxisorientierten Einführung wird auch (relativ kurz) die Erforschung und Erschließung des Weltraums angesprochen. |
|
| Bewertung vom 23.06.2022 | ||

|
Was, wenn es Leben außerhalb der Erde gäbe? Was, wenn Außerirdische auf unseren Planeten kommen würden? Wie würden sie aussehen? Was wären ihre Absichten? – Während die Unterhaltungsindustrie sich schon ausgiebig an diesem Thema versucht hat und sich sowohl gefährlichen feindlichen Angriffen gewidmet hat als auch skurillen, jedoch liebenswürdigen und moralisch oft höherstehenden Lebensformen, öffnet der bereits verstorbene amerikanische Autor Walter Tevis hier noch eine weitere Schublade, eine insgesamt weniger spektakuläre, aber doch bestechende: Was, wenn sie uns ähnlicher wären als angenommen?! |
|
| Bewertung vom 05.06.2022 | ||

|
In „Die Kinder sind Könige“ lernen wir zwei gegensätzliche Frauen kennen: Die zielstrebige, verschlossene Polizistin Clara, die als Protokollantin bei der Kriminalkommission arbeitet – und die nach Aufmerksamkeit lechzende Mélanie, Mutter zweier Kinder und Betreiberin des beliebtesten Familienkanals Frankreichs. |
|
| Bewertung vom 21.05.2022 | ||
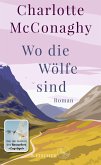
|
Vom Cover und Klappentext her hatte mich dieses Werk nicht sonderlich angesprochen, doch die Leseprobe - |
|
| Bewertung vom 30.04.2022 | ||

|
Mit hoher Literatur ist das so eine Sache: Im besten Fall eröffnet sie neue sprachliche Welten, die zu entdecken zwar Mühe kostet, aber gleichzeitig staunen lässt und bereichert. Im schlechtesten Fall wird sie zu einer Aneinanderreihung von Wörtern, deren Sinn sich den Lesenden vor lauter Verschwurbelung nicht mehr erschließt. |
|
