BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 1378 Bewertungen| Bewertung vom 07.10.2020 | ||

|
Die weltweite Vernetzung, kollabierende Finanzmärkte, Start Ups, digitale Kontrolle und die lückenlose Überwachung der Bürger, das alles sind Themen, die einen dankbaren Hintergrund für einen Politthriller abgeben. So auch in „Final Control“, und wenn dann noch ein skrupelloser Bösewicht, wie wir ihn aus den James Bond-Filmen kennen, die Finger im Spiel hat, verspricht das eine interessante Lektüre. Leider kann der Autor dieses Versprechen nicht einlösen, zu faktenlastig, zu viele überflüssige Erläuterungen und zu spannungsarm ist diese Story konstruiert. |
|
| Bewertung vom 07.10.2020 | ||

|
Und die Welt war jung / Drei-Städte-Saga Bd.1 Die fünfziger Jahre. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende, Aufbruchstimmung durchzieht das Land. Es ist eine Zeit der Verheißung, alles scheint möglich. Doch die Nachwirkungen der Kriegszeit sind überall spürbar, zeigen, dass nicht jede/r diese dunklen Jahre einfach abstreifen kann. |
|
| Bewertung vom 06.10.2020 | ||

|
Die erste Fernsehserie, die ich in meiner Kindheit atemlos verfolgt habe, war Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Ich durfte es bei einer Freundin anschauen, weil wir damals noch kein Fernsehgerät hatten, und ich erinnere mich, dass wir beide angespannt verfolgt haben, was da auf dem Bildschirm geschah. Augenblicke, die uns in unbekannte Welten mitnahmen, uns verzauberten. Die eine magische Verbindung zwischen der Marionette und dem Zuschauer schufen. Es war der Faden, der mitten unser Herz führte, vergessen ließ, dass Jim Knopf nur eine Holzpuppe war. |
|
| Bewertung vom 01.10.2020 | ||
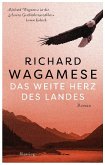
|
Richard Wagamese (1955 – 2017) ist ein indigener Autor aus Kanada (vom Stamm der Ojibwe, besser bekannt in der amerikanischen Bezeichnung Chippewa), der sich in der Tradition seines Volkes als „Geschichtenerzähler“ versteht. Wie so viele Kinder seines Volkes aus seiner Familie gerissen, durch zahlreiche Pflegefamilien geschleust, dann adoptiert. In Kontakt mit seiner Herkunft und den indigenen Traditionen kommt er erst im Erwachsenenalter und verarbeitet diese in seinen Romanen. |
|
| Bewertung vom 29.09.2020 | ||
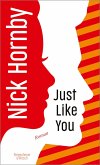
|
Um es gleich vorweg zu nehmen, für mich ist „Just like you“ nur sehr bedingt ein Brexit-Roman. Die Handlung ist zeitlich zwar rund um das Referendum angesiedelt, aber das Thema wird nur oberflächlich und lediglich in knappen Bemerkungen innerhalb der Gespräche der Protagonisten angeritzt, meist nur auf die Frage nach dem Wahlverhalten reduziert. Nur in einem kurzen Wortwechsel merkt man bei Josephs Vater die Hoffnung, die dieser mit dem Verlassen der EU verknüpft. Wobei er allerdings auch nur die Ausländer raus-Parolen nachbetet, die die Leaver im Vorfeld verbreitet haben. |
|
| Bewertung vom 28.09.2020 | ||

|
Älterer Mann begehrt junges Mädchen, ein Motiv, das wir spätestens seit Nabokovs „Lolita“ kennen. Nun sind im Zuge der #MeToo-Bewegung zahlreiche literarische Auseinandersetzungen mit dieser Thematik erschienen, in denen sich die Opfer, Frauen und Männer, zu Wort melden. Manches davon autobiografisch, anderes fiktional, aber dennoch mehr oder weniger von persönlichen Erfahrungen beeinflusst. So auch Kate Elizabeth Russells Debütroman, in dem Vanessa, ihre zweiunddreißigjährige Protagonistin, das Verhältnis zu ihrem ehemaligen Englischlehrer Revue passieren lässt. |
|
| Bewertung vom 26.09.2020 | ||

|
Südaustralien. Heiß, trocken, staubig und dünn bevölkert. Tiverton, die öde Kleinstadt, das Revier von Paul „Hirsch“ Hirschhausen, strafversetzter, weil zu ehrlicher Constable und Leiter der dortigen Polizeistation. Bagatelldiebstähle, Drogenkonsum, Alkoholismus, häusliche Gewalt, Kupferklau, entlaufene Haustiere, viel zu tun gibt es dort nicht, lauter Kleinkram. Ach ja, fast vergessen, Weihnachten steht vor der Tür und Hirsch muss nicht nur die Weihnachtsbeleuchtung prämieren sondern auch noch den Santa spielen. Aber mit dem besinnlichen Warten aufs Christkind wird es diesmal nichts werden, denn zwei ungewöhnliche Vorfälle reißen ihn aus der Routine und fordern seinen ganzen Einsatz. Wer massakriert Ponys und was hat es mit der toten Frau auf der abseits gelegenen Farm auf sich? Hirschs Einsatz ist gefordert, und schnell muss er feststellen, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. |
|
| Bewertung vom 24.09.2020 | ||

|
Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Diese Zeit wird als der „Hungerwinter“ in Erinnerung bleiben. Es ist eine Zeit der Unsicherheit, des Mangels. Den Menschen fehlt es an allem. Brennstoff ist knapp, die Grundnahrungsmittel gibt es, wenn überhaupt, auf Lebensmittelkarten. Das Geld ist nichts mehr wert, aber der Schwarzmarkt floriert. Und wer Schmuck, Pelze, teures Porzellan oder ähnliches über die Zeit retten konnte, findet noch immer Möglichkeiten, dort zumindest ab und zu die kargen Rationen zu ergänzen. Vordergründig sind die Nationalsozialisten entmachtet, aber bei genauem Hinschauen sieht man, dass die „alten Kameraden“ noch immer an den Schaltstellen sitzen und dort ihre Macht gnadenlos ausspielen. |
|
| Bewertung vom 23.09.2020 | ||

|
Ostpreußen im Januar 1945, das Ende des Krieges ist absehbar. Die Menschen haben Angst, sind verunsichert, denn die russischen Truppen sind auf dem Vormarsch. Viele entscheiden sich dazu, ihre Heimat zu verlassen, die Flucht ins Ungewisse anzutreten. So auch Rosa, die sich mit ihren beiden Kindern Alice und Emma auf den Weg gen Westen macht, nicht ahnend, dass die Mädchen unterwegs durch ein tragisches Ereignis auseinandergerissen werden… |
|
| Bewertung vom 22.09.2020 | ||

|
Eine Sommernacht in Red Hook, dem heruntergekommenen Hafenviertel an der Südspitze Brooklyns. Es ist schwül, die Hitze drückt. Außer Langeweile nichts geboten für June und Val. Zwei Teenager, ein rosa Schlauchboot, gegenüber die glitzernden Lichter der Metropole. Hier der Alltag, dort die Verheißung. Das tragische Ende dieses Ausflugs offenbart sich im Licht des Tages, denn es ist nur Val, die zurückkehrt. Angespült und halbtot. June bleibt verschwunden. Das Viertel in Aufruhr, Unfall oder Verbrechen? |
|