BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 874 Bewertungen| Bewertung vom 30.01.2019 | ||

|
Frauenfeindliche Spätromantik |
|
| Bewertung vom 22.01.2019 | ||
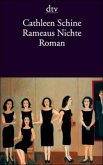
|
Warum liebe ich diesen Mann? |
|
| Bewertung vom 20.01.2019 | ||

|
Hypnos und Thanatos |
|
| Bewertung vom 14.01.2019 | ||

|
Zwiespältige Parabel 0 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 08.01.2019 | ||
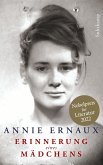
|
Weder Fisch noch Fleisch 2 von 5 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 05.01.2019 | ||

|
Von den fortschreitenden Übertretungen des Major Aebi Homer-Komplex |
|
| Bewertung vom 02.01.2019 | ||

|
Eins vorweg, «Der kleine Prinz» ist kein Märchenbuch für Kinder, auch wenn sein Protagonist ein kleiner Bub ist, der ganz allein auf einem winzigen Asteroiden lebt, «Der Planet seiner Herkunft war kaum größer als ein Haus», heißt es im Buch. Um der Einsamkeit dort zu entfliehen, andere Menschen kennen zu lernen, hat er ihn verlassen. Auf sechs nahe gelegenen anderen kleinen Planeten trifft er zuerst einen König, der ihn als seinen Untertanen betrachtet, dann einen Eitlen, den er bewundern soll, einen Säufer, der säuft, um zu vergessen, dass er säuft, einen Unternehmer, dem angeblich alle Sterne gehören, einen Laternenanzünder, der seine Pflicht allzu ernst nimmt, und einen Geografen, der dicke Bücher schreibt, in denen nichts von den wichtigen Dingen des Lebens geschrieben steht. Der Geograf rät ihm, den Planeten Erde zu besuchen, «er hat einen guten Ruf». Ich-Erzähler dieser Geschichte ist ein Pilot, der wegen Motorschadens in der Wüste notlanden musste, beide sind sie quasi vom Himmel gefallen, wie sie lachend feststellen. Sie freunden sich schnell an, und der Prinz erzählt von seinem Planeten, seiner Reise auf die Erde und von seinen Erlebnissen. 2 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 30.12.2018 | ||

|
Ohne Liebe kein Leben |
|
| Bewertung vom 24.12.2018 | ||

|
Ein Kanon-Roman |
|
| Bewertung vom 12.12.2018 | ||

|
Selbstbild mit russischem Klavier Elegischer Musikerroman |
|
