BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 874 Bewertungen| Bewertung vom 10.12.2018 | ||
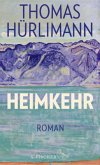
|
Parodistische Odyssee 0 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 06.12.2018 | ||

|
Surrealer Eskapismus |
|
| Bewertung vom 03.12.2018 | ||

|
Auf dem Weg zum besseren Menschen 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 02.12.2018 | ||

|
Literatur im Fokus |
|
| Bewertung vom 27.11.2018 | ||

|
Mein Jahr der Ruhe und Entspannung 9/11 als Katharsis 2 von 4 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 23.11.2018 | ||

|
Ein Kultroman |
|
| Bewertung vom 18.11.2018 | ||

|
Die Kirmeswelt als Antithese 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 10.11.2018 | ||

|
Keine archäologische Grabung 7 von 7 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 06.11.2018 | ||

|
Elegant und federleicht erzählt 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 04.11.2018 | ||

|
Nicht mal «Die Grünen» 0 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
